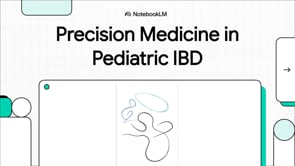Die Präzisionsmedizin revolutioniert die Behandlung von Kindern mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED), indem sie individuelle Patientendaten nutzt, um die passende Therapie in optimaler Dosierung und zum idealen Zeitpunkt auszuwählen. Dieser umfassende Ansatz kombiniert genetische, mikrobielle und proteinbasierte Biomarker, um Krankheitsverläufe und Therapieansprechen vorherzusagen. Ziel ist es, die derzeitige therapeutische Grenze zu überwinden, bei der lediglich 20–50 % der Patienten eine Remission erreichen. Durch frühzeitige, gezielte Interventionen und sogar die Erforschung von Präventionsstrategien bietet die Präzisionsmedizin neue Hoffnung, Komplikationen, operative Eingriffe und Langzeitfolgen bei pädiatrischen CED zu verringern.
Ein Leitfaden für Patienten zur Präzisionsmedizin bei pädiatrischen chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Warum Präzisionsmedizin bei pädiatrischen CED wichtig ist
- Richtiger Patient: Identifikation von Patienten mit Bedarf für aggressive Therapie
- Klinische und laborchemische Prädiktoren
- Serologische Marker
- Genetische Risikofaktoren
- Proteomische Biomarker
- Genexpressionsmuster
- Darmmikrobiom-Faktoren
- Klinische Entscheidungsunterstützungssysteme
- Richtige Therapie: Anpassung der Behandlung an Patientenprofile
- Anti-TNF-Therapien
- Anti-Integrin-Therapien
- IL-12/IL-23-Therapien
- Pharmakogenomik: Genetik und Arzneimittelsicherheit
- Richtige Dosierung: Optimierung der Medikamentenspiegel
- Therapeutisches Drug-Monitoring
- Zusammenfassung: Die Zukunft der Präzisionsmedizin bei CED
- Quelleninformationen
Einleitung: Warum Präzisionsmedizin bei pädiatrischen CED wichtig ist
Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED), einschließlich Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, nehmen weltweit seit der industriellen Revolution zu. Etwa 25 % aller CED-Fälle werden vor dem 20. Lebensjahr diagnostiziert, was sie häufig zu einer Erkrankung im Kindesalter macht. Während die Inzidenz in Nordamerika und Westeuropa stabil ist, steigt die Gesamtzahl der CED-Patienten aufgrund alternder bestehender Patienten und beschleunigter Neuerkrankungen in neu industrialisierten Ländern weiter an.
Die globale Belastung durch CED nimmt erheblich zu, was aufgrund der erheblichen Morbidität und hohen Behandlungskosten zu einer Belastung für Patienten und Gesundheitssysteme führt. Die Präzisionsmedizin bietet einen entscheidenden Ansatz, um die Versorgungseffizienz für diese wachsende Patientengruppe zu verbessern und potenziell Präventionsstrategien zu identifizieren.
Es wird allgemein von einer "therapeutischen Decke" bei CED ausgegangen, bei der alle Behandlungen, sowohl alte als auch neue, nur bei 20–50 % der Patienten zu einer Remission führen, wobei viele, die zunächst ansprechen, im Laufe der Zeit ihr Ansprechen verlieren. Mit jedem erfolglosen Therapieversuch erleben Patienten anhaltende Entzündungen und Darmschäden, die zu Hospitalisierung, Operation, Komplikationen, Fibrose, Behinderung und sogar kolorektalem Karzinom führen können.
Richtiger Patient: Identifikation von Patienten mit Bedarf für aggressive Therapie
Pädiatrische CED sind äußerst heterogen mit verschiedenen Subtypen und komplizierenden extraintestinalen Manifestationen. Da ein frühzeitiger Beginn einer effektiven Therapie ideal ist, wird die Unterscheidung zwischen Patienten mit niedrigem und hohem Risiko für Progression und Komplikationen entscheidend für die Steuerung der initialen Therapiewahl.
Derzeit bewerten Kliniker klinische und laborchemische Merkmale eher grob, um das Progressionsrisiko zu bestimmen. In Zukunft werden große Datenbanken genomischer, proteomischer, mikrobieller und metabolomischer Signaturen weiter expandieren und in Risikovorhersagemodelle integriert werden. Kliniker können mithilfe von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen diese präziseren Risikomodelle nutzen, um Hochrisikopatienten für frühe aggressive Interventionen besser zu identifizieren, während Niedrigrisikopatienten unnötige aggressive Behandlungen erspart bleiben.
Klinische und laborchemische Prädiktoren
Klinische Merkmale und routinelaborchemische Befunde wurden mit kompliziertem Krankheitsverlauf und/oder Operationen bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa assoziiert:
Prädiktoren bei pädiatrischem Morbus Crohn:
- Stenosierende Erkrankung bei Erstdiagnose
- Pädiatrischer Crohn-Aktivitätsindex (PCDAI) > 10 in Woche 12 nach Therapiebeginn
- Längere Krankheitsdauer und jüngeres Alter bei Diagnose (assoziiert mit 46 % endoskopischem Rezidiv 2 Jahre postoperativ trotz Biologika-Einsatz)
- Ileale Erkrankungslokalisation und höheres Alter bei Diagnose
- C-reaktives Protein (CRP) ≥ 5 mg/dL (assoziiert mit mittelschwerer bis schwerer Erkrankung)
Prädiktoren bei pädiatrischer Colitis ulcerosa:
- Pankolitis (Entzündung des gesamten Kolons)
- Schwere Kolitis (PUCAI > 65) bei Diagnose
- Hypoalbuminämie (niedriges Albumin) bei Diagnose
- PUCAI-Score > 10 nach 3-monatiger Therapie
Serologische Marker
Antikörperreaktionen gegen intestinale Organismen wurden zur Risikovorhersage genutzt. Die Rate komplizierter und progredienter Verläufe bei Morbus Crohn steigt mit zunehmender Immunreaktivität. Patienten mit zwei oder mehr serologischen Markern (ASCA, OmpC und/oder CBir1) entwickelten schneller eine komplizierte Erkrankung als solche mit nur einem Marker.
Bei Colitis ulcerosa wurde hochtitriges (>100 EU/mL) pANCA mit Pankolitis und chronischer Pouchitis nach Operation assoziiert.
Genetische Risikofaktoren
Große genetische Studien haben Risikoloki in der DNA identifiziert, die mit kompliziertem Krankheitsverlauf assoziiert sind. Das stärkste identifizierte Risikoallel ist NOD2, ursprünglich assoziiert mit kompliziertem Morbus Crohn definiert als Strikturentwicklung und Operationsbedarf.
Weitere Risikoloki (FOXO3, XACT, IGFBP1 und die MHC-Region zwischen HLA-B und HLA-DR) wurden als mit schlechter Prognose assoziiert identifiziert, bedürfen aber weiterer Validierung. Bei Colitis ulcerosa ist das HLA DRB1*0103-Allel mit Pankolitis und Kolektomiebedarf assoziiert.
Ein genomweiter polygener Risikoscore, der die additiven Effekte genetischer Varianten einbezieht, kann das Risiko bestimmter Phänotypen basierend auf dem Genotyp abschätzen. Für CED zeigte dieser Score eine Fläche unter der Kurve (AUC) von 0,63 in beiden Test- und Validierungsdatensätzen, was bedeutet, dass er Patienten in 63 % der Fälle korrekt klassifizierte.
Proteomische Biomarker
Ein wichtiges Ziel der Präzisionsmedizin bei CED ist die Identifikation von Biomarkern, die Calprotectin im Stuhl bei der Detektion endoskopischer Befunde übertreffen können, ohne Probleme durch Patientenumzufriedenheit oder Non-Adhärenz.
In der RISK-Kohortenstudie wurden mit einem Panel von Blutproteinmarkern fünf Proteine mit penetrierenden Komplikationen (AUC 0,79, 95 % CI: 0,76–0,82) und vier Proteine mit stenosierenden Komplikationen (AUC 0,68, 95 % CI: 0,65–0,71) assoziiert. Kollagen Typ III alpha 1-Kette (COL3A1)-Spiegel bei Diagnose waren bei Patienten, die Strikturen entwickelten, höher.
Ein Panel von 13 Proteinmarkern (serologischer endoskopischer Heilungsindex) wurde bei Morbus Crohn validiert, um endoskopische Aktivität vergleichbar zu Calprotectin im Stuhl und überlegen zu CRP zu unterscheiden.
Genexpressionsmuster
Spezifische Genexpressionsprofile wurden mit CED-Prognose und Erkrankungstyp verknüpft. Bei Morbus Crohn war eine hohe ileale Expression von Genen der extrazellulären Matrix mit späterer Strikturentwicklung assoziiert. Ein transkriptioneller Risikoscore, abgeleitet von Genexpression assoziiert mit bekannten CED-Risikoallelen, zeigt Potenzial bei der Identifikation von Crohn-Patienten, die im Laufe der Zeit Komplikationen entwickeln könnten.
Eine kommerziell verfügbare transkriptionelle Signatur in peripheren CD8-T-Zellen, assoziiert mit T-Zell-Erschöpfung, zeigte vielversprechende initiale Ergebnisse als potenzieller Prädiktor für aggressivere Erkrankung und wird derzeit validiert.
Bei Colitis ulcerosa war ein Typ-2-Genexpressionsmuster mit höherer Wahrscheinlichkeit für das Erreichen klinischer Remission assoziiert. Höhere Eosinophilenzahlen waren mit geringerer Wahrscheinlichkeit für Eskalation von 5-ASA zu Anti-TNF-Therapie assoziiert.
Darmmikrobiom-Faktoren
Ein Ungleichgewicht in der mikrobiellen Zusammensetzung im Vergleich zu gesunden Kontrollen, genannt Dysbiose, wird bei CED häufig gefunden. Diese Dysbiose zeichnet sich durch verminderte bakterielle Diversität und Abundanz aus, mit zunehmenden Hinweisen auf Rollen von Pilzen und Viren.
In einer pädiatrischen CED-Kohorte war schwere mikrobielle Dysbiose mit ausgedehnten und/oder komplizierten Krankheitsphänotypen, Biologika-Therapie und Versagen mukosaler Heilung assoziiert. Klassifikatoren, die Mikrobiomstruktur und metabolische Aktivität beschreiben, sind mit CED-Status assoziiert.
Klinische Entscheidungsunterstützungssysteme
Alle diese Merkmale werden zunehmend in umfassende klinische Entscheidungsunterstützungssysteme integriert, die direkt in elektronische Patientenakten eingebunden werden können. Derzeit gibt es ein kommerziell verfügbares Tool für Morbus Crohn (CD-PATH), das Patienten basierend auf klinischen, serologischen und genetischen Markern mit 75 % prädiktiver Genauigkeit bei Kindern in Niedrig-, Mittel- und Hochrisikogruppen einteilt.
Für Vedolizumab identifizierte ein Entscheidungsunterstützungssystem unter Verwendung klinischer und laborchemischer Befunde Patienten, die wahrscheinlich eine kortikosteroidfreie Remission erreichen, und differenzierte solche, die Intervallverkürzung benötigen würden.
Richtige Therapie: Anpassung der Behandlung an Patientenprofile
Die Therapiewahl basiert derzeit auf klinischen Faktoren wie Progressionsrisiko sowie Erkrankungslokalisation, -schwere und -aktivität. Die erste Biologika-Therapie hat unabhängig von der Wahl die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit.
Die Therapiesequenz beeinflusst ebenfalls die Wirksamkeit. Bei Colitis ulcerosa ist Vedolizumab weniger effektiv, wenn es nach Anti-TNF-Therapie gegeben wird, während dieser negative Effekt bei Ustekinumab weniger ausgeprägt ist. Mit jedem erfolglosen Therapieversuch erleben Patienten Symptome während des Wartens auf Ansprechen, was zu Behinderung, Kortikosteroid-Exposition und Gesundheitsressourcennutzung führt.
Anti-TNF-Therapien
Mehrere baseline Genexpressionsprofile wurden bei mit Anti-TNF behandelten CED-Patienten identifiziert, die mit späterem Non-Response assoziiert sind. Höhere Expression von Oncostatin M (OSM) war mit Anti-TNF-Non-Response assoziiert (relatives Risiko = 5, 95 % CI: 1,4–17,9) mit einer beeindruckenden AUC von 0,99.
Niedrige Expression des Triggering Receptor Expressed on Myeloid cells 1 (TREM-1) wurde ebenfalls mit Non-Response auf Anti-TNF bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa assoziiert. Ein zelluläres Modul bestehend aus IgG-Plasmazellen, inflammatorischen mononukleären Phagozyten, aktivierten T-Zellen und Stromazellen war mit dem Versagen, eine steroidfreie klinische Remission unter Anti-TNF-Therapie zu erreichen, assoziiert.
Anti-Integrin-Therapien
In einer retrospektiven Kohorte von 251 CED-Patienten sagte prätherapeutische kolonische Mukosa-Eosinophilie Non-Response auf Vedolizumab nach 6 Monaten voraus. Zirkulierendes α4β7 könnte ebenfalls ein Marker für Vedolizumab-Ansprechen sein.
Ein neuronales Netzwerkalgorithmus zur Vorhersage klinischer Remission in Woche 14 unter Vedolizumab hatte verbesserte prädiktive Power, wenn mikrobielle Daten mit klinischen Daten kombiniert wurden (nur klinische Daten: AUC = 0,619; klinische und mikrobielle Daten: AUC = 0,872). Erhöhte mikrobielle Diversität bei Baseline war mit Ansprechen auf Vedolizumab assoziiert.
IL-12/IL-23-Therapien
In einer klinischen Studie mit Brazikumab (einer Anti-IL-23-Therapie) für Morbus Crohn zeigten Konzentrationen von Interleukin-22 (IL-22), gemessen bei Baseline, dass Spiegel über 15,6 pg/mL mit erhöhter Wahrscheinlichkeit klinischer Remission in Woche 8 assoziiert waren.
Es gibt eine erhöhte Rate von Psoriasis bei CED im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung und eine höhere Inzidenz familiärer Psoriasis bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Varianten im IL23R-Gen verleihen Schutz bei Psoriasis und CED, und Therapien, die diesen Pathway targetieren, haben sich bei beiden Erkrankungen als effektiv erwiesen.
Pharmakogenomik: Genetik und Arzneimittelsicherheit
Thiopurine (6-Mercaptopurin und Azathioprin) zählen zu den ersten Medikamenten, die bei CED eingesetzt werden, können jedoch lebensbedrohliche Nebenwirkungen wie Leukopenie und Pankreatitis verursachen. Diese Medikamente werden durch das Enzym Thiopurin-Methyltransferase (TPMT) metabolisiert.
Die wohl am längsten etablierte Präzisionsmedizin-Strategie bei CED ist die Nutzung von TPMT-Genotypisierung oder Enzymspiegeln zur Bestimmung der Thiopurin-Dosierung. In einer großen niederländischen Studie wiesen Träger von TPMT-Varianten mit Dosisreduktion eine 10-fache Verringerung leukopenischer Ereignisse auf (RR: 0,11; 95 %-KI: 0,01–0,85).
Eine genetische Variante in NUDT15 wurde ebenfalls als mit einem erhöhten Risiko für Leukopenie unter Thiopurinen assoziiert identifiziert und kann additive Effekte mit TPMT-Varianten zeigen. Derzeit wird empfohlen, vor Beginn einer Thiopurin-Therapie sowohl TPMT als auch NUDT15 zu testen, um die Dosierung zu steuern oder den Einsatz bei einer kleinen Hochrisikogruppe möglicherweise zu vermeiden.
Die HLA-DQA1*05-Allelgruppe ist mit dem Zeitpunkt bis zur Entwicklung von Antikörpern gegen Anti-TNF-Therapeutika assoziiert (Hazard Ratio: 1,90; 95 %-KI: 1,60–2,25). Dieser Test ist mittlerweile kommerziell für den klinischen Einsatz verfügbar.
Weitere genetische Varianten, die mit ungünstigen Outcomes assoziiert sind, umfassen einen Polymorphismus in der HLA-Klasse-II-Region (rs2647087), der mit einem erhöhten Pankreatitisrisiko unter Thiopurinen einhergeht – homozygote Träger dieses Gens haben ein 17 %iges Risiko, eine Pankreatitis zu entwickeln.
Richtige Dosis: Optimierung der Medikamentenspiegel
Da CED-Therapien nur begrenzt wirksam sind, müssen sie rational ausgewählt und optimiert werden, um den Behandlungserfolg zu maximieren und zu überprüfen, ob pharmakokinetische Parameter die Wirksamkeit nicht limitieren. Diese Optimierung umfasst Dosis- und Intervallanpassungen oder die Hinzunahme einer Kombinationstherapie, oft basierend auf therapeutic drug monitoring (TDM).
Therapeutisches Drug-Monitoring (TDM)
Therapeutisches Drug-Monitoring wird zur Optimierung von Thiopurinen und Biologika eingesetzt. Bei Thiopurinen ist die Überprüfung von Metabolitenspiegeln seit Langem etablierte Praxis. Bei alleiniger Anwendung können Thiopurin-Metabolitenspiegel kontrolliert werden, um eine angemessene Dosierung sicherzustellen.
Fazit: Die Zukunft der Präzisionsmedizin bei CED
Präzisionsmedizin bei pädiatrischen chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) stellt einen transformativen Behandlungsansatz dar, der über Einheitslösungen hinausgeht. Durch die Integration verschiedener Patientendaten – einschließlich genetischer, proteomischer, mikrobieller und klinischer Informationen – können Kliniker den Krankheitsverlauf besser vorhersagen, optimale Therapien auswählen, geeignete Dosierungen bestimmen und Interventionen zeitlich richtig setzen.
Die Entwicklung klinischer Entscheidungshilfen, die elektronische Patientenakten einbeziehen, wird diese komplexen Vorhersagen für Kliniker zugänglicher machen. Da die Forschung weiterhin zusätzliche Biomarker validiert und bestehende Algorithmen verfeinert, verspricht die Präzisionsmedizin nicht nur, die derzeitige therapeutische Decke zu durchbrechen, sondern potenziell zuvor unerreichbare Ziele wie die Krankheitsprävention bei Risikopersonen zu ermöglichen.
Für Patienten und Familien, die mit pädiatrischen CED konfrontiert sind, bieten diese Fortschritte Hoffnung auf wirksamere, personalisierte Behandlungen, die Trial-and-Error-Ansätze minimieren und das Risiko von Komplikationen, Hospitalisierungen und Operationen verringern, während die langfristige Lebensqualität verbessert wird.
Quelleninformation
Originaltitel des Artikels: Precision Medicine in Pediatric Inflammatory Bowel Disease
Autoren: Elizabeth A. Spencer, MD, Marla C. Dubinsky, MD
Veröffentlichung: Pediatric Clinics of North America, Volume 68, Issue 6, Dezember 2021, Seiten 1171–1190
Hinweis: Dieser patientenfreundliche Artikel basiert auf peer-reviewter Forschung und zielt darauf ab, komplexe wissenschaftliche Informationen in zugängliche Inhalte für gebildete Patienten und Betreuer zu übersetzen.