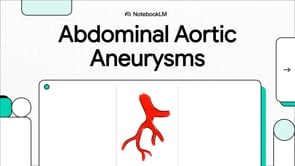Dieser Fall betrifft eine 32-jährige Frau, die plötzlich unter Flankenschmerzen, Fieber und Atemnot litt. Die Symptome führten zur Diagnose einer schwerwiegenden Nierenerkrankung: einer Phospholipase-A2-Rezeptor-assoziierten membranösen Nephropathie. Der Fall zeigt, wie diese Autoimmunerkrankung bei zuvor gesunden jungen Erwachsenen zu massivem Proteinverlust im Urin, gefährlich niedrigen Blutproteinkonzentrationen und lebensbedrohlichen Blutgerinnseln in Nierenvenen und Lunge führen kann. Die Diagnose wurde durch spezifische Blutuntersuchungen gesichert, die Anti-PLA2R-Antikörper nachwiesen, wodurch eine sofortige Nierenbiopsie vermieden werden konnte.
Die Reise einer jungen Frau mit Nierenerkrankung und Blutgerinnseln: Einblicke in die membranöse Nephropathie
Inhaltsverzeichnis
- Fallvorstellung: Die Geschichte der Patientin
- Symptome und erste Befunde
- Ergebnisse der körperlichen Untersuchung
- Laborbefunde
- Bildgebende Befunde
- Differenzialdiagnose
- Diagnostische Tests
- Behandlung der Erkrankung
- Klinische Implikationen für Patienten
- Einschränkungen dieses Falls
- Empfehlungen für Patienten
- Quelleninformation
Fallvorstellung: Die Geschichte der Patientin
Eine 32-jährige Frau stellte sich mit starken linksseitigen Flankenschmerzen, Fieber und niedrigen Sauerstoffwerten im Krankenhaus vor. Ihre Beschwerden hatten zwei Wochen zuvor mit stechenden, intermittierenden Schmerzen in der linken Flanke begonnen, die sich zwei Tage vor der Aufnahme deutlich verschlimmerten, nun dauerhaft waren und von Übelkeit begleitet wurden. Am Vortag der Einweisung kam es mehrfach zum Erbrechen.
Am Aufnahmetag entwickelte sie einen trockenen Husten und fühlte sich fiebrig, ohne die Temperatur gemessen zu haben. In einer Notfallpraxis wurden eine Temperatur von 38,1°C, eine Herzfrequenz von 113 Schlägen pro Minute und eine Sauerstoffsättigung von 95% unter Raumluft festgestellt. Zudem bestand eine Bauchdeckenspannung im linken Unterbauch, jedoch kein Klopfschmerz über den Nieren.
Symptome und erste Befunde
Die ersten Laborwerte zeigten mehrere Auffälligkeiten. Die Leukozytenzahl war mit 19.000 pro Mikroliter deutlich erhöht (Norm: 3.800–10.800), was auf eine ausgeprägte Immunreaktion oder Infektion hindeutete. Der Albuminspiegel im Blut war mit 2,8 g/dL erniedrigt (Norm: 3,3–5,5 g/dL) und sprach für einen Proteinverlust.
Die Urinanalyse ergab besorgniserregende Befunde: 3+ Blut und 3+ Protein (beide normalerweise negativ). Ihre Sauerstoffsättigung sank in der Praxis auf 89%, sodass eine Sauerstoffgabe von 3 Litern pro Minute über eine Nasenbrille nötig war, um 94% zu halten. Diese Ergebnisse führten zur Verlegung in die Krankenhaus-Notaufnahme.
Ergebnisse der körperlichen Untersuchung
In der Notaufnahme verschlechterte sich ihr Zustand. Die Temperatur stieg auf 39,6°C, der Blutdruck betrug 102/58 mm Hg, die Herzfrequenz erhöhte sich auf 122 Schläge pro Minute und die Atemfrequenz beschleunigte auf 28 Atemzüge pro Minute. Sie benötigte weiterhin Sauerstoff.
Bei der Untersuchung wirkte sie deutlich reduziert. Über beiden Lungen fanden sich inspiratorische und exspiratorische Rasselgeräusche. Im linken Unterbauch bestand ein Druckschmerz. Auffälligerweise fehlten Schwellungen der Extremitäten, Mundgeschwüre, Haarausfall oder Hautausschlag, was einige Autoimmunerkrankungen unwahrscheinlich machte.
Laborbefunde
Umfangreiche Laboruntersuchungen lieferten entscheidende Hinweise. Die Leukozyten blieben mit 16.020 pro Mikroliter erhöht, mit Dominanz der Neutrophilen (14.210 Zellen). Die Urinanalyse zeigte weiterhin 3+ Blut und 3+ Protein, mit über 100 Erythrozyten pro Gesichtsfeld (Norm: 0–2) und 10–20 Leukozyten pro Gesichtsfeld (Norm: <10).
Das Protein-Kreatinin-Verhältnis im Urin war mit 3,5 stark erhöht (Norm: <0,15), was einem täglichen Proteinverlust von etwa 3,5 Gramm entspricht – ein Leitsymptom des nephrotischen Syndroms. Weitere wichtige Befunde:
- C-reaktives Protein (Entzündungsparameter): 199,9 mg/L (Norm: 0–8,0)
- Blutsenkungsgeschwindigkeit: 40 mm/Stunde (Norm: 0–19)
- Laktatdehydrogenase: 278 U/L (Norm: 110–210)
- Laktat: 2,2 mmol/L (Norm: 0,5–2,0)
- HbA1c: 6,2% (Norm: 4,3–5,6%)
Die Nierenfunktion war mit einem Kreatinin von 0,93 mg/dL im Normbereich; ohne Ausgangswert ließ sich eine akute Schädigung jedoch nicht ausschließen.
Bildgebende Befunde
Bildgebende Verfahren erklärten die Symptome. Das Röntgen-Thorax zeigte fleckige Verschattungen an den Lungenbasen und einen kleinen linksseitigen Pleuraerguss. Die CT des Thorax mit Kontrastmittel ergab:
- Einen partiellen Füllungsdefekt in der rechten Unterlappenarterie, verdächtig auf Lungenembolie
- Bronchialwandverdickungen und multifokale Konsolidierungen mit Milchglastrübungen
- Kleine beidseitige Pleuraergüsse
- Bereiche mit interlobulärer Septumverdickung und Milchglastrübungen
Die CT von Abdomen und Becken zeigte weitere signifikante Befunde:
- Einen fast vollständigen Verschluss (okklusiver Thrombus) der linken Nierenvene
- Einen teilweisen Verschluss (nicht-okklusiver Thrombus) der rechten Nierenvene
- Frühe heterogene Kontrastmittelanreicherung der Nieren mit perinephritischen Septen
- Keine Hinweise auf Malignome
Diese Befunde erklärten die Flankenschmerzen (durch Nierenvenenthrombosen) und die Atemnot (durch Lungenembolie und pulmonale Veränderungen).
Differenzialdiagnose
Es wurden mehrere Erkrankungen erwogen, die Nieren- und Lungenbeteiligung erklären könnten. Initial stand ein pulmorenales Syndrom im Vordergrund, typisch für Autoimmunerkrankungen wie:
- ANCA-assoziierte Vaskulitis
- Anti-GBM-Erkrankung (Goodpasture-Syndrom)
- Systemischer Lupus erythematodes mit Nierenbeteiligung
- Antiphospholipid-Syndrom
- Kryoglobulinämische Vaskulitis
Das Fehlen bestimmter Merkmale machte diese jedoch unwahrscheinlicher. Der Fokus verlagerte sich auf das nephrotische Syndrom mit schwerer Proteinurie (>3,5 g/Tag), niedrigem Albumin und Ödemen. Nierenvenenthrombosen wiesen besonders auf eine membranöse Nephropathie hin, die unter Nierenerkrankungen am stärksten mit Thrombosen assoziiert ist.
Andere Ursachen schienen weniger plausibel:
- Minimal-Change-Glomerulonephritis und fokal segmentale Glomerulosklerose: typisch mit Ödemen, weniger mit Thrombosen
- Diabetische Nephropathie: unwahrscheinlich bei HbA1c von 6,2%
- Lupusnephritis: keine Anzeichen für Autoimmunsymptome
- Sekundäre Ursachen: keine Anhaltspunkte für Infektion, Tumor oder Medikamente
Diagnostische Tests
Zur Abklärung wurden spezifische Bluttests durchgeführt. Anti-PLA2R-Antikörper, assoziiert mit primärer membranöser Nephropathie, wurden mit zwei Methoden getestet:
- Indirekter Immunfluoreszenztest: positiv für PLA2R-Bindung
- ELISA: quantitativ 400,3 RU/mL (Norm: <14 RU/mL)
Die positiven Ergebnisse zusammen mit dem klinischen Bild bestätigten die Diagnose einer Phospholipase-A2-Rezeptor-assoziierten membranösen Nephropathie. Der Test hat eine Spezifität von 99%.
Behandlung der Erkrankung
Die Therapie der membranösen Nephropathie richtet sich nach dem individuellen Risiko. Bei erhaltener Nierenfunktion wird oft zunächst abgewartet, da etwa 30% der Patienten spontan remittieren. Bei dieser Patientin waren jedoch sofortige Maßnahmen nötig aufgrund:
- Schwerer Hypoalbuminämie (Albumin <2,5 g/dL)
- Multipler thromboembolischer Ereignisse (Nierenvenenthrombosen und Lungenembolie)
- Hoher Anti-PLA2R-Antikörperspiegel (400,3 RU/mL)
Die Standardtherapie ist das modifizierte Ponticelli-Schema mit alternierenden Kortikosteroiden und Alkylanzien (z.B. Cyclophosphamid) über 6 Monate. Neuere Konzepte berücksichtigen den Antikörperverlauf: sinkende Werte können ein Abwarten rechtfertigen, steigende Werte erfordern Immunsuppression.
Zusätzlich wurde eine Antikoagulation zur Behandlung der Thrombosen eingeleitet.
Klinische Implikationen für Patienten
Dieser Fall unterstreicht mehrere wichtige Aspekte: Flankenschmerzen mit Fieber und Atemnot – besonders bei niedriger Sauerstoffsättigung – sollten ernst genommen werden. Die Kombination aus Proteinurie und Thrombosen an ungewöhnlichen Lokalisationen wie den Nierenvenen weist auf eine membranöse Nephropathie hin.
Patienten sollten verstehen, dass es sich um eine Autoimmunerkrankung handelt, bei der Antikörper die Nierenfilterzellen (Podozyten) angreifen. Dadurch kommt es zum Proteinverlust im Urin.
Das Thromboserisiko ist besonders hoch, weil der Proteinverlust zu Mangel an gerinnungshemmenden Proteinen führt, während die Leber vermehrt Gerinnungsfaktoren produziert. Besonders gefährdet sind Patienten mit Albuminwerten unter 2,5 g/dL.
Einschränkungen dieses Falls
Als Einzelfallbericht lassen sich keine allgemeingültigen Schlüsse ziehen. Die Familienanamnese (Schwester mit terminaler Niereninsuffizienz) deutet auf genetische Faktoren hin, die nicht vollständig abgeklärt wurden.
Ohne Nierenbiopsie können Begleiterkrankungen nicht absolut ausgeschlossen werden, auch wenn die spezifischen Antikörpertests sehr aussagekräftig sind. Langzeitdaten zum Therapieansprechen fehlen.
Empfehlungen für Patienten
Für Patienten ergeben sich folgende Empfehlungen:
- Suchen Sie bei anhaltenden Flankenschmerzen mit Fieber oder Atemnot umgehend ärztliche Hilfe auf.
- Lassen Sie bei unklaren Schwellungen, besonders mit Flankenschmerzen oder Atemproblemen, eine Urinuntersuchung durchführen.
- Fragen Sie bei Verdacht auf nephrotisches Syndrom nach Anti-PLA2R-Antikörpertests zur nicht-invasiven Diagnosesicherung.
- Besprechen Sie bei nephrotischem Syndrom mit niedrigem Albumin (<2,5 g/dL) eine Thromboseprophylaxe mit Ihrem Nephrologen.
- Führen Sie regelmäßige Kontrollen bei Nephrologie und Hämatologie durch, da Risiken für Nierenversagen und Thrombosen bestehen.
Patienten sollten wissen, dass laufend neue Therapien für autoimmune Nierenerkrankungen entwickelt werden, und eine spezialisierte nephrologische Betreuung essenziell ist.
Quelleninformation
Originaltitel: Case 10-2025: A 32-Year-Old Woman with Flank Pain, Fever, and Hypoxemia
Autoren: Anushya Jeyabalan, MD; Cynthia L. Czawlytko, MD; Laurence H. Beck, Jr., MD, PhD; Claire Trivin-Avillach, MD; Dennis C. Sgroi, MD; Eric S. Rosenberg, MD
Veröffentlichung: The New England Journal of Medicine, 10. April 2025; 392:1428–1437
DOI: 10.1056/NEJMcpc2412517
Dieser patientengerechte Artikel basiert auf begutachteter Forschung aus den Case Records des Massachusetts General Hospital.