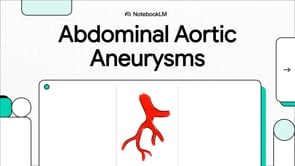Diese Fallstudie beschreibt eine 29-jährige Patientin mit seit sieben Wochen anhaltenden Halsschmerzen, Schwellungen und Blutungen, die auf mehrere Antibiotikabehandlungen nicht ansprachen. Nach umfangreicher Diagnostik wurde schließlich ein embryonales Rhabdomyosarkom festgestellt – ein seltener Weichteiltumor. Der Fall verdeutlicht die Notwendigkeit, bei therapieresistenten Rachenbeschwerden eine Krebserkrankung abzuklären, und zeigt den komplexen Diagnoseprozess auf, der zur sicheren Identifizierung erforderlich ist.
Die Reise einer jungen Frau mit anhaltenden Halsschmerzen: Verständnis einer ungewöhnlichen Krebsdiagnose
Inhaltsverzeichnis
- Fallvorstellung: Die Geschichte der Patientin
- Ersteinschätzung und Behandlung
- Diagnostischer Prozess und Bildgebung
- Differentialdiagnose: Was könnte es sein?
- Pathologische Befunde und Diagnose
- Klinische Implikationen für Patientinnen und Patienten
- Einschränkungen des Falles
- Empfehlungen für Patientinnen und Patienten
- Quelleninformation
Fallvorstellung: Die Geschichte der Patientin
Eine 29-jährige, bislang gesunde Frau stellte sich mit besorgniserregenden Halssymptomen vor, die seit sieben Wochen anhielten. Ihre medizinische Odyssee begann mit Halsschmerzen, die sich nach einer Woche nicht besserten, weshalb sie ihre Hausarztpraxis aufsuchte. Erste Tests auf COVID-19 und Streptokokken-Angina fielen negativ aus, und man riet ihr zu Ruhe und ausreichend Flüssigkeit.
In den folgenden vier Tagen verschlimmerten sich ihre Halsschmerzen erheblich und wurden so stark, dass sie ihren Schlaf beeinträchtigten. Sie suchte erneut die Praxis auf und erhielt Azithromycin, ein Antibiotikum. Doch auch nach fünf Tagen Behandlung zeigte sich keine Besserung. Der anhaltende Schmerz und die Schwellung auf der rechten Halsseite veranlassten sie, 31 Tage vor ihrer endgültigen Aufnahme ins Massachusetts General Hospital, die Notaufnahme aufzusuchen.
Während dieses Notfallbesuchs schilderte sie das Gefühl, dass Nahrung beim Schlucken "stecken bleibe", sowie Müdigkeit, aber kein Fieber, keine Atembeschwerden oder andere systemische Symptome. Ihre Vitalzeichen waren normal: Temperatur 36,9°C, Blutdruck 105/77 mm Hg, Herzfrequenz 74 Schläge pro Minute und Sauerstoffsättigung 99% unter Raumluft.
Ersteinschätzung und Behandlung
Die Ärzte stellten ein Ödem (Schwellung) und eine Fluktuation (flüssigkeitsgefüllter Bereich) im rechten peritonsillären Bereich (dem Raum um die Mandeln) fest, wobei die Uvula (das herunterhängende Gewebe im Rachen) nach links abwich. Bemerkenswerterweise bestand kein Trismus (Kiefersteife), keine Lymphknotenvergrößerung oder Hautausschlag. Ihre Leukozytenzahl betrug 6.700 pro Mikroliter, was im Normbereich von 4.000–11.000 lag.
Die initiale Behandlung umfasste Amoxicillin-Clavulanat, ein weiteres Antibiotikum, woraufhin sie mit der Anweisung entlassen wurde, einen Hals-Nasen-Ohren (HNO)-Facharzt aufzusuchen. 26 Tage vor ihrer endgültigen Aufnahme erfolgte eine Inzision und Drainage, die 3 ml blutige Flüssigkeit anstelle von Eiter ergab.
Am nächsten Tag kehrte sie mit verstärkten Schmerzen, Schwellung und Blutung von der Inzisionsstelle zurück. Die Ärzte stellten vermehrte Schwellung, Hämatombildung (Bluterguss), fragile Schleimhaut und etwas nekrotisches Gewebe fest. Sie versuchten, weitere Flüssigkeit zu drainieren und evakuierten ein Hämatom (Blutansammlung), doch die Blutung hielt an, was eine dringende Operation zur Blutstillung mit speziellen Mitteln erforderlich machte.
Diagnostischer Prozess und Bildgebung
Die Bildgebung spielte eine entscheidende Rolle bei ihrer Diagnose. Eine Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel zeigte eine hypodense (weniger dichte) Läsion von 2,6 cm × 2,1 cm × 3,8 cm im rechten peritonsillären Bereich. Die Raumforderung wies eine minimale Randverstärkung auf und verursachte eine leichte Einengung des Oropharynx (Rachenraum).
Einen Monat später zeigte ein CT-Angiogramm, dass die Läsion auf 3,4 cm × 3,6 cm × 4,6 cm mit komplexer Dichte angewachsen war. Sie erstreckte sich nun in den weichen Gaumen und Nasopharynx (oberer Rachenbereich hinter der Nase). Die Raumforderung war vom rechten Musculus pterygoideus medialis nicht abgrenzbar, zeigte aber keine Muskelvergrößerung oder -ödeme.
Die Laborwerte bei der endgültigen Aufnahme zeigten eine erhöhte Leukozytenzahl von 13.470 pro Mikroliter (Norm: 4.500–11.000) mit erhöhten Neutrophilen (8.970, Norm: 1.800–7.700). Ihr Hämoglobin betrug 15,1 g/dL (Norm: 12,0–16,0) und der Hämatokrit 44,9% (Norm: 36,0–46,0), bei normaler Thrombozytenzahl und Gerinnungsstudien.
Differentialdiagnose: Was könnte es sein?
Das Behandlungsteam erwog mehrere Möglichkeiten für ihre Diagnose. Anfangs schien ein peritonsillärer Abszess (Eiteransammlung nahe den Mandeln) angesichts ihrer Symptome und der Lokalisation wahrscheinlich. Das Fehlen von Fieber, Trismus, Lymphknotenvergrößerung und das Ausbleiben von Eiter bei der Drainage machten dies jedoch weniger plausibel.
Sie erweiterten ihre Überlegungen auf:
- Autoimmunerkrankungen wie systemischer Lupus erythematodes oder Vaskulitiden
- Granulomatöse Erkrankungen wie Sarkoidose
- Infiltrative Erkrankungen wie Amyloidose
- Gutartige Tumoren einschließlich Papillomen, Fibromen oder Speicheldrüsentumoren
- Bösartige Krebserkrankungen wie Plattenepithelkarzinom, Lymphom, Speicheldrüsenkrebs oder Sarkom
Das schnelle Wachstumsmuster, die Blutungsneigung und das Fehlen von Lymphknotenbefall ließen ein Sarkom (eine Art Bindegewebskrebs) als wahrscheinlich erscheinen. Die Lokalisation im peritonsillären Raum mit verschiedenen Gewebetypen machte mehrere Krebsarten ohne Biopsiebestätigung möglich.
Pathologische Befunde und Diagnose
Die definitive Diagnose ergab sich aus den Biopsieergebnissen. Die mikroskopische Untersuchung zeigte Tumorzellen mit Skelettmuskeldifferenzierung. Die immunhistochemische Färbung (spezielles Gewebetestverfahren) ergab, dass die Tumorzellen positiv für Desmin und MyoD1 (muskelspezifische Marker) und fokal positiv für Myogenin (ein weiterer Muskelmarker) waren.
Molekularpathologische Tests waren entscheidend für die Bestätigung. Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH)-Tests schlossen FOXO1-Umlagerungen aus und eliminierten damit effektiv ein alveoläres Rhabdomyosarkom. Next-Generation-Sequenzierung identifizierte Varianten im RAS-Signalweg, einschließlich Mutationen in HRAS- und GNAS-Genen.
Die endgültige Diagnose lautete embryonales Rhabdomyosarkom, ein seltener Weichteilsarkom, der typischerweise Kinder betrifft, aber gelegentlich bei Erwachsenen auftreten kann. Die zytogenetische Analyse ergab einen komplexen Karyotyp einschließlich Trisomie 8 (ein zusätzliches Chromosom 8), das bei Rhabdomyosarkomen vorkommen kann.
Klinische Implikationen für Patientinnen und Patienten
Dieser Fall verdeutlicht mehrere wichtige Punkte für Patientinnen und Patienten mit persistierenden Symptomen. Erstens: Halssymptome, die nicht auf eine angemessene Antibiotikatherapie ansprechen, erfordern eine weitergehende Abklärung über Infektionen hinaus. Das Fehlen typischer Infektionszeichen wie Fieber oder Eiter schließt ernste Erkrankungen nicht aus.
Zweitens: Der diagnostische Prozess bei seltenen Erkrankungen erfordert oft multiple Ansätze: körperliche Untersuchung, Bildgebungsverfahren, Labortests und letztlich Gewebebiopsie mit speziellen molekularpathologischen Tests. Die siebenwöchige Reise von ersten Symptomen zur Diagnose unterstreicht, wie komplex die Identifikation seltener Erkrankungen sein kann.
Drittens: Rhabdomyosarkome bei Erwachsenen sind außergewöhnlich selten und machen weniger als 1% der Erwachsenenkrebse aus. Im Kopf-Hals-Bereich können sie mit Symptomen auftreten, die häufige Infektionen imitieren, was die Diagnose erschwert. Früherkennung ist entscheidend für optimale Behandlungsergebnisse.
Einschränkungen des Falles
Dieser Fallbericht beschreibt die Erfahrung einer einzelnen Patientin, was bedeutet, dass die Befunde nicht auf alle Patientinnen und Patienten mit ähnlichen Symptomen verallgemeinert werden können. Die Seltenheit embryonaler Rhabdomyosarkome bei Erwachsenen bedeutet, dass dies eine ungewöhnliche Präsentation eher als ein häufiges Szenario darstellt.
Der diagnostische Prozess dauerte mehrere Wochen und erforderte multiple Interventionen, was möglicherweise nicht den idealen Zeitrahmen für die Identifikation solcher Erkrankungen widerspiegelt. Der Fall liefert keine Langzeit-Follow-up-Informationen über Therapieansprechen oder Outcomes, sondern konzentriert sich auf die diagnostische Herausforderung.
Zusätzlich machten das relativ junge Alter der Patientin und das Fehlen typischer Krebsrisikofaktoren (Nichtraucherin, kein Alkoholkonsum) Krebs zu einer weniger unmittelbaren Überlegung, was die Diagnose in ähnlichen Fällen verzögern könnte.
Empfehlungen für Patientinnen und Patienten
Basierend auf diesem Fall sollten Patientinnen und Patienten:
- Eine Wiedervorstellung anstreben, wenn Symptome trotz angemessener Behandlung über erwartete Zeiträume hinaus persistieren
- Überweisung zu Fachärztinnen und Fachärzten anfordern, wenn allgemeine Behandlungen die Symptome nicht beheben
- Erweiterte Bildgebung in Betracht ziehen, wenn körperliche Befunde nicht den erwarteten Mustern entsprechen
- Verstehen, dass eine Biopsie notwendig sein kann, wenn weniger invasive Methoden keine Antworten liefern
- Bewusst sein, dass seltene Erkrankungen manchmal persistierende Symptome erklären können, die nicht in gängige Muster passen
Bei spezifisch anhaltenden Halssymptomen sollten Patientinnen und Patienten beachten, dass das Fehlen typischer Infektionszeichen (Fieber, Eiter, Lymphknotenvergrößerung) auf nicht-infektiöse Ursachen hinweisen könnte, die andere diagnostische Ansätze erfordern. Blutungen aus Rachenbereichen, besonders ohne klare Ursache, erfordern immer eine gründliche Abklärung.
Quelleninformation
Originalartikeltitel: Fall 14-2025: Eine 29-jährige Frau mit peritonsillärer Schwellung und Blutung
Autoren: Rahmatullah Wais Rahmati, Katherine L. Reinshagen, Rosh K.V. Sethi, David S. Shulman, Emily M. Hartsough
Veröffentlichung: The New England Journal of Medicine, 2025;392:1954–1964
DOI: 10.1056/NEJMcpc2300972
Dieser patientenfreundliche Artikel basiert auf peer-reviewter Forschung aus den Case Records des Massachusetts General Hospital.