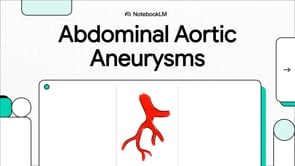Diese umfassende Studie verglich über fünf Jahre die Wirksamkeit von sechs gängigen Multipler-Sklerose-Therapien anhand von Daten von 23.236 Patienten aus 35 Ländern. Die Forscher stellten fest, dass Natalizumab das Rückfallrisiko um 56 % und die Behinderungsprogression um 57 % im Vergleich zu Glatirameracetat senkte, während Fingolimod die Rückfallrate um 40 % reduzierte. Die Studie liefert robuste Belege dafür, dass hochwirksame Therapien einen besseren Schutz vor Krankheitsaktivität bieten, wobei Natalizumab die stärksten Effekte sowohl auf Rückfälle als auch auf den Behinderungsverlauf zeigte.
Vergleich von Multipler Sklerose-Therapien: Welche Behandlungen wirken über 5 Jahre am besten?
Inhaltsverzeichnis
- Warum diese Forschung wichtig ist
- Wie die Forschung durchgeführt wurde
- Detaillierte Behandlungsergebnisse im Vergleich
- Was dies für Patienten bedeutet
- Was die Studie nicht beweisen konnte
- Praktische Ratschläge für Patienten
- Quelleninformationen
Warum diese Forschung wichtig ist
Multiple Sklerose (MS) ist eine chronische neurologische Erkrankung, bei der das Immunsystem die Schutzschicht der Nervenfasern angreift. Krankheitsmodifizierende Therapien (KMT) können Schübe reduzieren, das Fortschreiten der Behinderung verlangsamen und den Übergang zu fortgeschritteneren MS-Stadien verzögern. Angesichts der vielen verfügbaren Behandlungsoptionen benötigen Patienten und Neurologen klare Belege dafür, welche Therapien langfristig am besten wirken.
Randomisierte klinische Studien vergleichen meist eine Behandlung mit Placebo, selten jedoch mehrere Therapien direkt miteinander. Dadurch besteht eine erhebliche Wissenslücke darüber, welche Behandlung für welche Patienten am wirksamsten ist. Diese internationale Studie zielte darauf ab, diese Lücke durch die Analyse von Real-World-Daten Tausender Patienten über bis zu fünf Jahre zu schließen.
Das Forschungsteam verwendete fortschrittliche statistische Methoden, um zu simulieren, was eine Multibehandlungs-Studie ergeben würde, wenn sie praktisch durchführbar wäre. Verglichen wurden sechs häufig eingesetzte Therapien: Natalizumab (Tysabri), Fingolimod (Gilenya), Dimethylfumarat (Tecfidera), Teriflunomid (Aubagio), Interferon beta (verschiedene Marken) und Glatirameracetat (Copaxone) sowie keine Behandlung.
Wie die Forschung durchgeführt wurde
Forscher analysierten Daten von 23.236 Patienten mit schubförmig remittierender MS oder klinisch isoliertem Syndrom (einer frühen Form von MS) aus 74 medizinischen Zentren in 35 Ländern. Die Daten stammten aus dem MSBase-Register, einer internationalen Datenbank, die MS-Patienten langfristig erfasst. Die Patienten wurden ab ihrem ersten Klinikbesuch mit dokumentierten Behinderungsdaten nachverfolgt, im Durchschnitt über 2,8 Jahre.
Die Studie nutzte ausgefeilte statistische Verfahren, sogenannte marginale Strukturmodelle, um Behandlungen zu vergleichen und dabei Unterschiede zwischen Patientengruppen zu berücksichtigen. Dieser Ansatz half, die Vergleichsgruppen in wichtigen Faktoren auszugleichen wie:
- Alter, Geschlecht und Schwangerschaftsstatus
- Krankheitsdauer und Behinderungsgrad
- Vorherige Behandlungsgeschichte
- Kürzliche Schubaktivität
- MRT-Befunde (sofern verfügbar)
Patienten wurden ab ihrer ersten dokumentierten Behandlung analysiert und bis zum Wechsel der Therapie, zum Abbruch oder bis zum Studienende nachverfolgt. Untersucht wurden drei Hauptendpunkte: Schubhäufigkeit, bestätigte Verschlechterung der Behinderung (mindestens 12 Monate anhaltend) und bestätigte Verbesserung der Behinderung (ebenfalls mindestens 12 Monate anhaltend).
Die statistischen Methoden erstellten gewichtete Vergleiche, die im Wesentlichen die Frage stellten: "Was würde passieren, wenn dieselbe Gruppe von Patienten unterschiedliche Behandlungen erhielte?" Dies ermöglichte fairere Vergleiche zwischen Therapien, die in der Praxis typischerweise verschiedenen Patiententypen verschrieben werden.
Detaillierte Behandlungsergebnisse im Vergleich
Die Studie lieferte zwei Arten von Vergleichen: durchschnittliche Behandlungseffekte (ATE), die zeigen, wie Behandlungen bei allen Patienten abschneiden würden, und durchschnittliche Behandlungseffekte bei Behandelten (ATT), die zeigen, wie Behandlungen in den spezifischen Patientengruppen abschneiden, die sie typischerweise erhalten.
Schubreduktion
Im Vergleich zu Glatirameracetat (als Referenzbehandlung) zeigten mehrere Therapien eine überlegene Wirksamkeit bei der Reduktion von Schüben:
- Natalizumab: 56%ige Reduktion des Schubrisikos (HR=0,44, 95% CI=0,40 bis 0,50)
- Fingolimod: 40%ige Reduktion des Schubrisikos (HR=0,60, 95% CI=0,54 bis 0,66)
- Dimethylfumarat: 22%ige Reduktion des Schubrisikos (HR=0,78, 95% CI=0,66 bis 0,92)
- Teriflunomid: 11%ige Reduktion, nicht statistisch signifikant (HR=0,89, 95% CI=0,75 bis 1,06)
- Interferon beta: 5%ige Reduktion, grenzwertig signifikant (HR=0,95, 95% CI=0,89 bis 1,00)
- Keine Behandlung: 35%iges erhöhtes Schubrisiko (HR=1,35, 95% CI=1,27 bis 1,44)
Verschlechterung der Behinderung
Zur Verhinderung einer bestätigten Verschlechterung der Behinderung (mindestens 12 Monate anhaltend):
- Natalizumab: 57%ige Reduktion des Risikos für Behinderungsverschlechterung (HR=0,43, 95% CI=0,32 bis 0,56)
- Fingolimod: 15%ige Reduktion, nicht statistisch signifikant (HR=0,85, 95% CI=0,67 bis 1,06)
- Dimethylfumarat: 14%ige Reduktion, nicht statistisch signifikant (HR=0,86, 95% CI=0,51 bis 1,47)
- Teriflunomid: 44%ige Reduktion (HR=0,56, 95% CI=0,31 bis 0,99)
- Interferon beta: 8%iges erhöhtes Risiko, nicht signifikant (HR=1,08, 95% CI=0,96 bis 1,23)
- Keine Behandlung: 4%iges erhöhtes Risiko, nicht signifikant (HR=1,04, 95% CI=0,89 bis 1,21)
Verbesserung der Behinderung
Zur Förderung einer bestätigten Verbesserung der Behinderung (mindestens 12 Monate anhaltend):
- Natalizumab: 32%ige erhöhte Chance auf Verbesserung (HR=1,32, 95% CI=1,08 bis 1,60)
- Fingolimod: 18%ige erhöhte Chance, nicht signifikant (HR=1,18, 95% CI=0,96 bis 1,46)
- Dimethylfumarat: 15%ige erhöhte Chance, nicht signifikant (HR=1,15, 95% CI=0,82 bis 1,60)
- Teriflunomid: 30%ige reduzierte Chance, nicht signifikant (HR=0,70, 95% CI=0,44 bis 1,11)
- Interferon beta: 3%ige erhöhte Chance, nicht signifikant (HR=1,03, 95% CI=0,91 bis 1,18)
- Keine Behandlung: 9%ige reduzierte Chance, nicht signifikant (HR=0,91, 95% CI=0,78 bis 1,05)
Die paarweisen Vergleiche (ATT-Modelle) bestätigten, dass Natalizumab und Fingolimod durchweg bessere Effekte bei der Schubreduktion und den Behinderungsergebnissen zeigten als andere Therapien. Diese Ergebnisse blieben konsistent, selbst wenn MRT-Befunde berücksichtigt wurden und verschiedene Referenzbehandlungen zum Vergleich herangezogen wurden.
Was dies für Patienten bedeutet
Diese Studie liefert starke Belege dafür, dass nicht alle MS-Behandlungen gleich wirksam sind. Hochwirksame Therapien, insbesondere Natalizumab und Fingolimod, zeigten signifikant bessere Ergebnisse bei der Reduktion von Schüben und der Verhinderung des Behinderungsfortschreitens im Vergleich zu moderat wirksamen Therapien.
Für Patienten mit aktiver schubförmig remittierender MS deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass der Beginn mit oder der Wechsel zu hochwirksamen Behandlungen einen besseren langfristigen Schutz vor Krankheitsaktivität bieten kann. Die 56%ige Reduktion des Schubrisikos mit Natalizumab und 40%ige Reduktion mit Fingolimod stellen erhebliche klinische Vorteile dar, die zu weniger Krankenhausaufenthalten, weniger Arbeitsausfällen und besserer Lebensqualität führen könnten.
Die Behinderungsergebnisse sind besonders wichtig, da sie das langfristige Fortschreiten widerspiegeln, das die tägliche Funktionsfähigkeit erheblich beeinträchtigt. Die 57%ige Reduktion des Risikos für Behinderungsverschlechterung und die 32%ige erhöhte Chance auf Behinderungsverbesserung mit Natalizumab legen nahe, dass es nicht nur das Krankheitsfortschreiten verlangsamen, sondern möglicherweise auch einige Funktionserholung ermöglichen könnte.
Diese Ergebnisse unterstützen das Konzept der "Eskalationstherapie" – Beginn mit hochwirksamen Therapien für Patienten mit aktiverer Erkrankung, anstatt einem schrittweisen Ansatz zu folgen, der mit moderat wirksamen Behandlungen beginnt. Dieser Ansatz könnte helfen, irreversible Behinderungsakkumulation über die Zeit zu verhindern.
Was die Studie nicht beweisen konnte
Obwohl diese Studie wertvolle Real-World-Belege liefert, hat sie mehrere Einschränkungen, die Patienten verstehen sollten:
- Keine randomisierte Studie: Trotz fortschrittlicher statistischer Methoden bleibt dies eine Beobachtungsstudie, was bedeutet, dass Behandlungsentscheidungen von Ärzten und Patienten getroffen wurden, nicht durch zufällige Zuteilung
- Behandlungsauswahlbias: Hochwirksame Therapien werden oft Patienten mit aktiverer Erkrankung verschrieben, was ihre Ergebnisse weniger günstig erscheinen lassen könnte, als sie tatsächlich sind
- Fehlende MRT-Daten: Viele Patienten hatten keine vollständigen MRT-Informationen, obwohl Sensitivitätsanalysen mit MRT-Daten ähnliche Ergebnisse zeigten
- Nebenwirkungen und Sicherheit: Die Studie konzentrierte sich auf die Wirksamkeit, verglich aber nicht Nebenwirkungen, Risiken oder Sicherheitsprofile der verschiedenen Behandlungen
- Neuere Behandlungen: Einige neuere MS-Therapien waren nicht enthalten, da sie während des Studienzeitraums (2006-2019) nicht weit verbreitet waren
Die Forscher stellten fest, dass bestimmte Faktoren schwer vollständig zwischen Behandlungsgruppen auszugleichen waren, insbesondere Behinderungsgrade bei Natalizumab-Patienten und kürzliche Schubaktivität bei Fingolimod-Patienten. Sie passten diese verbleibenden Unterschiede statistisch an, aber einige Unsicherheit bleibt.
Praktische Ratschläge für Patienten
Basierend auf diesen Ergebnissen sollten MS-Patienten Folgendes berücksichtigen, wenn sie Behandlungsoptionen mit ihrem Neurologen besprechen:
- Besprechen Sie Wirksamkeitslevel: Fragen Sie Ihren Arzt nach der relativen Wirksamkeit verschiedener Therapieoptionen, nicht nur nach ihren Nebenwirkungsprofilen
- Berücksichtigen Sie Ihre Krankheitsaktivität
- Denken Sie langfristig: Behinderungsergebnisse über Jahre hinweg sind wichtiger als alleinige kurzfristige Schubreduktion
- Überprüfen Sie regelmäßig das Ansprechen auf die Behandlung
- Balancieren Sie Nutzen und Risiken: Während Wirksamkeit wichtig ist, berücksichtigen Sie auch Sicherheitsüberwachungsanforderungen, Verabreichungsmethode und potenzielle Nebenwirkungen
- Nehmen Sie an Registern teil
Denken Sie daran, dass Behandlungsentscheidungen personalisiert basierend auf Ihren spezifischen Krankheitsmerkmalen, Lebensstil, Präferenzen und Risikotoleranz getroffen werden sollten. Diese Studie liefert wertvolle Belege über vergleichende Wirksamkeit, aber individuelle Ansprechraten auf Behandlungen können variieren.
Quelleninformationen
Originalartikeltitel: Effectiveness of multiple disease-modifying therapies in relapsing-remitting multiple sclerosis: causal inference to emulate a multiarm randomised trial
Autoren: Ibrahima Diouf, Charles B Malpas, Sifat Sharmin, Izanne Roos, Dana Horakova, Eva Kubala Havrdova, Francesco Patti, Vahid Shaygannejad, Serkan Ozakbas, Sara Eichau, Marco Onofrj, Alessandra Lugaresi, Raed Alroughani, Alexandre Prat, Pierre Duquette, Murat Terzi, Cavit Boz, Francois Grand'Maison, Patrizia Sola, Diana Ferraro, Pierre Grammond, Bassem Yamout, Ayse Altintas, Oliver Gerlach, Jeannette Lechner-Scott, Roberto Bergamaschi, Rana Karabudak, Gerardo Iuliano, Christopher McGuigan, Elisabetta Cartechini, Stella Hughes, Maria Jose Sa, Claudio Solaro, Ludwig Kappos, Suzanne Hodgkinson, Mark Slee, Franco Granella, Koen de Gans, Pamela A McCombe, Radek Ampapa, Anneke van der Walt, Helmut Butzkueven, José Luis Sánchez-Menoyo, Steve Vucic, Guy Laureys, Youssef Sidhom, Riadh Gouider, Tamara Castillo-Trivino, Orla Gray, Eduardo Aguera-Morales, Abdullah Al-Asmi, Cameron Shaw, Talal M Al-Harbi, Tunde Csepany, Angel P Sempere, Irene Treviño Frenk, Elizabeth A Stuart, Tomas Kalincik
Veröffentlichung: Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 2023;94:1004-1011
Hinweis: Dieser patientenfreundliche Artikel basiert auf einer begutachteten Studie, die Daten von 23.236 Patienten aus 35 Ländern über einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren analysiert hat.