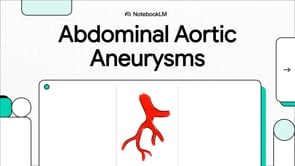In dieser umfassenden Real-World-Studie wurden zwei führende Multiple-Sklerose-Therapien – Ocrelizumab und Natalizumab – über einen Nachbeobachtungszeitraum von fast fünf Jahren verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass beide Medikamente die Krankheitsaktivität der Multiplen Sklerose (MS) gleichermaßen wirksam kontrollierten, ohne signifikante Unterschiede bei der Verhinderung von Schüben, MRT-Läsionen oder dem Fortschreiten von Behinderungen. Allerdings war Ocrelizumab mit mehr leichten bis mittelschweren Nebenwirkungen verbunden, wies jedoch vergleichbare oder leicht bessere Therapietreueraten auf. Das bedeutet, dass Patientinnen und Patienten tendenziell länger mit dieser Medikation behandelt wurden.
Vergleich von Ocrelizumab und Natalizumab bei Multipler Sklerose: Eine 5-Jahres-Real-World-Studie
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Verständnis der MS-Therapien
- Durchführung der Studie
- Detaillierte Studienergebnisse
- Vergleich der Therapiesicherheit
- Therapietreue der Patienten
- Bedeutung für Patienten
- Studienlimitationen
- Patientenempfehlungen
- Quellenangaben
Einleitung: Verständnis der MS-Therapien
Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des Zentralnervensystems, die Gehirn und Rückenmark betrifft. In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich die Behandlungsmöglichkeiten durch die Entwicklung zahlreicher krankheitsmodifizierender Therapien (KMT) erheblich erweitert, die über verschiedene Mechanismen die Erkrankung kontrollieren.
Zu den wirksamsten Behandlungen zählen monoklonale Antikörper wie Natalizumab (Handelsname Tysabri) und Ocrelizumab (Ocrevus). Diese hochwirksamen Therapien werden häufig früh im Krankheitsverlauf empfohlen, um irreversible Schäden und das Fortschreiten der Behinderung zu verhindern. Bisher gab es jedoch nur begrenzte Langzeitdaten aus der klinischen Praxis, die diese beiden Behandlungen außerhalb von Studien vergleichen.
Natalizumab wirkt, indem es Immunzellen am Übertritt in Gehirn und Rückenmark hindert, während Ocrelizumab gezielt B-Zellen eliminiert, die zur Entzündung bei MS beitragen. Diese Studie zielte darauf ab, Patienten und Kliniken umfassende 5-Jahres-Daten zur Wirksamkeit, Sicherheit und Therapietreue dieser Behandlungen zu liefern.
Durchführung der Studie
Forscher führten eine retrospektive Analyse von 308 MS-Patienten durch, die an zwei italienischen Universitätskliniken behandelt wurden – der Sapienza Universität Rom und der Universität Neapel "Federico II". Die Studie umfasste 168 mit Natalizumab und 140 mit Ocrelizumab behandelte Patienten mit einer durchschnittlichen Nachbeobachtungszeit von 75,7 Monaten (etwa 6,3 Jahre).
Um faire Vergleiche zwischen den Behandlungsgruppen zu gewährleisten, verwendeten die Forscher eine statistische Methode namens Propensity-Score-Matching. Diese Technik erzeugte 70 gematchte Patientenpaare (140 Patienten insgesamt), die in Alter, Geschlecht, Vortherapiestatus, MS-Typ, Erkrankungsdauer und Krankheitsaktivität zu Studienbeginn vergleichbar waren. Nach dem Matching betrug die durchschnittliche Nachbeobachtungszeit beider Gruppen 55,9 Monate (etwa 4,7 Jahre).
Die Studie bewertete drei Hauptendpunkte:
- Wirksamkeit: Gemessen an "keiner Evidenz für Krankheitsaktivität" (NEDA-3), was keine Schübe, keine neuen MRT-Läsionen und keine bestätigte Behinderungsprogression bedeutet
- Sicherheit: Dokumentation aller unerwünschten Ereignisse mit standardisierten medizinischen Klassifikationssystemen
- Therapietreue: Dauer der Behandlung bis zum Abbruch oder Wechsel
Die Forscher verwendeten komplexe statistische Modelle, um Unterschiede in der Behandlungsdauer zu berücksichtigen und genaue Vergleiche zwischen den Medikamenten zu gewährleisten.
Detaillierte Studienergebnisse
Die Studie zeigte mehrere wichtige Erkenntnisse zur Wirksamkeit beider Behandlungen in der klinischen Praxis über fast 5 Jahre Beobachtungszeit.
Nach 5 Jahren erreichten 50,5% der Natalizumab-Patienten und 65% der Ocrelizumab-Patienten den NEDA-3-Status. Obwohl dies einen zahlenmäßigen Vorteil für Ocrelizumab nahelegt, war der Unterschied statistisch nicht signifikant [HR 0,64 (0,34–1,24), p=0,187], was bedeutet, dass er zufällig aufgetreten sein könnte.
Bei den Schüben beobachtete das Forschungsteam 7 Schübe in der Natalizumab-Gruppe und 3 in der Ocrelizumab-Gruppe. Ein Schub trat innerhalb eines Monats nach Natalizumab-Beginn auf und wurde von der Analyse ausgeschlossen, da er wahrscheinlich ein Rebound-Phänomen der Vortherapie darstellte. Der Unterschied in den Schubraten war nicht signifikant [HR 0,41 (0,11–1,57), p=0,193].
Die MRT-Aktivität zeigte ähnliche Muster – 7 Patienten unter Natalizumab und 3 unter Ocrelizumab zeigten neue Läsionen ohne signifikanten Unterschied zwischen den Behandlungen [HR 0,37 (0,10–1,44), p=0,152]. Die Behinderungsprogression, speziell Progression unabhängig von Schubaktivität (PIRA), trat in beiden Gruppen ohne signifikante Unterschiede auf [HR 1,43 (0,60–3,40), p=0,417].
Die Wahrscheinlichkeit, zu bestimmten Zeitpunkten frei von Krankheitsaktivität zu bleiben, betrug:
- Nach 1 Jahr: 85,7% unter Natalizumab vs. 92,9% unter Ocrelizumab schubfrei
- Nach 3 Jahren: 82,9% vs. 90% schubfrei
- Nach 5 Jahren: 82,9% vs. 90% schubfrei
Vergleich der Therapiesicherheit
Die Sicherheitsanalyse zeigte wichtige Unterschiede zwischen den Behandlungen. Patienten unter Ocrelizumab hatten ein signifikant höheres Risiko für unerwünschte Ereignisse verglichen mit Natalizumab [OR 4,50 (1,53–16,50), p=0,011].
Von 140 gematchten Patienten erlitten 19 unerwünschte Ereignisse – 4 in der Natalizumab- und 15 in der Ocrelizumab-Gruppe. Keines dieser Ereignisse war lebensbedrohlich, die meisten wurden als mild bis moderat eingestuft.
Die berichteten unerwünschten Ereignisse umfassten:
- Infusionsbedingte Reaktionen (häufiger bei Ocrelizumab)
- COVID-19-Infektionen mit Behandlungs- oder Hospitalisierungsbedarf
- Andere Infektionen
- Laborveränderungen inklusive Anämie, Lymphozytopenie und Hypogammaglobulinämie
- Entwicklung autoimmuner Erkrankungen (Psoriasis, autoimmune Thrombozytopenie)
- Ein Fall von Brustkrebs
- Kleinere chirurgische Eingriffe (Entfernung eines Endometriumpolypen)
Sieben der 15 Ocrelizumab-Patienten mit unerwünschten Ereignissen stammten ursprünglich aus Studienkohorten, was die Berichtshäufigkeit beeinflusst haben könnte.
Therapietreue der Patienten
Die Therapietreue, also die Dauer der Behandlung ohne Wechsel oder Abbruch, zeigte interessante Muster. Zunächst fand die Analyse keine signifikanten Unterschiede in den Abbruchraten [OR 0,58 (0,26–1,26), p=0,174].
In einer Sensitivitätsanalyse ohne Patienten, die in andere MS-Zentren wechselten (1 Natalizumab-, 8 Ocrelizumab-Patienten), zeigte sich jedoch eine höhere Abbruchwahrscheinlichkeit unter Natalizumab [OR=0,26 (0,09–0,67), p=0,008] verglichen mit Ocrelizumab.
Die Abbruchgründe unterschieden sich zwischen den Gruppen:
Natalizumab-Abbrüche (21 Patienten):
- 15 aufgrund von John-Cunningham-Virus (JCV)-Positivität
- 1 aufgrund unerwünschter Ereignisse
- 2 aufgrund von Schwangerschaft
- 1 Wechsel in anderes Zentrum
- 1 verloren in Nachbeobachtung
- 1 aufgrund von Behinderungsprogression
Ocrelizumab-Abbrüche (14 Patienten):
- 8 Wechsel in andere MS-Zentren
- 2 aufgrund von Behinderungsprogression
- 1 aufgrund unerwünschter Ereignisse
- 1 aufgrund von Schwangerschaft
- 1 verloren in Nachbeobachtung
- 1 aufgrund patientenseitiger Entscheidung
Die meisten Patienten wechselten nach Therapieabbruch auf eine andere KMT, wobei Cladribin die häufigste Wahl nach Natalizumab-Abbruch war.
Bedeutung für Patienten
Diese Studie liefert wertvolle Real-World-Evidenz, dass sowohl Natalizumab als auch Ocrelizumab hochwirksame Langzeitbehandlungen für Multiple Sklerose sind. Die vergleichbare Wirksamkeit bedeutet, dass Therapieentscheidungen stärker auf patientenindividuellen Faktoren basieren können als auf vermeintlicher Überlegenheit eines Medikaments.
Für Patienten mit Sorgen um Krankheitsaktivität zeigten beide Medikamente starke Performance in der Prävention von Schüben, neuen MRT-Läsionen und Behinderungsprogression über fast 5 Jahre Behandlung. Die ähnlichen NEDA-3-Raten legen nahe, dass beide Behandlungen umfassende Krankheitskontrolle bieten können, wenn sie für den spezifischen MS-Typ und die Patientencharakteristika geeignet sind.
Die Sicherheitsbefunde zeigen, dass Ocrelizumab ein höheres Risiko für milde bis moderate unerwünschte Ereignisse birgt, insbesondere Infusionsreaktionen, Infektionen und Laborveränderungen. In beiden Gruppen traten jedoch keine lebensbedrohlichen Ereignisse auf. Diese Information kann Patienten und Ärzten bei informierten Entscheidungen basierend auf individuellem Risikoprofil und Krankengeschichte helfen.
Die Therapietreuedaten deuten an, dass Patienten unter Ocrelizumab langfristig eher bei der Behandlung bleiben verglichen mit Natalizumab, besonders unter Berücksichtigung des häufigen Wechsels von Natalizumab bei JCV-Positivität.
Studienlimitationen
Trotz wertvoller Real-World-Evidenz weist diese Studie mehrere Limitationen auf, die bei der Ergebnisinterpretation berücksichtigt werden sollten. Das retrospektive Design bedeutet, dass Forscher bestehende Krankenakten analysierten statt Patienten prospektiv mit festgelegten Untersuchungsplänen zu verfolgen.
Die Studienpopulation stammte nur aus zwei italienischen Zentren, was die Übertragbarkeit auf diversere Populationen oder andere Gesundheitssysteme limitieren könnte. Zusätzlich könnte die Einbeziehung von Studienpatienten Bias eingeführt haben, da diese typischerweise intensiver überwacht werden.
Der Matching-Prozess kann trotz statistischer Rigorosität nicht alle möglichen Confounding-Faktoren abbilden, die Behandlungsergebnisse beeinflussen könnten. Einige Baseline-Unterschiede blieben zwischen den Gruppen bestehen, besonders in der Behandlungsdauer, was statistische Adjustierung erforderte.
Schließlich schloss die Studie Patienten aus, die zwischen Natalizumab und Ocrelizumab wechselten, was bedeutet, dass die Ergebnisse möglicherweise nicht auf diese spezifische Population zutreffen, die manchmal sequenzielle Behandlung mit beiden Medikamenten benötigt.
Patientenempfehlungen
Basierend auf dieser Forschung können Patienten und Kliniker folgende Aspekte bei Therapieentscheidungen berücksichtigen:
- Beide Behandlungen sind hochwirksam: Keines der Medikamente zeigte klare Überlegenheit in der Kontrolle der MS-Aktivität über 5 Jahre
- Sicherheitsprofile beachten: Ocrelizumab birgt ein höheres Risiko für milde bis moderate Nebenwirkungen, besonders Infusionsreaktionen und Infektionen
- JCV-Status besprechen: Natalizumab erfordert regelmäßige Kontrolle auf John-Cunningham-Virus-Antikörper; Positivität erfordert oft Therapiewechsel
- Therapietreue evaluieren: Ocrelizumab könnte für manche Patienten bessere langfristige Therapiekontinuität bieten
- Individuelle Faktoren berücksichtigen: Die Therapiewahl sollte Erkrankungstyp, Vortherapien, Familienplanung und persönliche Präferenz einbeziehen
Patienten sollten ausführliche Gespräche mit ihren Neurologen über diese Ergebnisse und deren individuelle Relevanz führen. Regelmäßige Kontrollen und Nachsorge bleiben unabhängig von der gewählten Therapie essentiell.
Quellenangaben
Originaltitel: Comparative effectiveness, safety and persistence of ocrelizumab versus natalizumab in multiple sclerosis: A real-world, multi-center, propensity score-matched study
Autoren: Elena Barbutia, Alessia Castiellob, Valeria Pozzillic, Antonio Carotenutob, Ilaria Tomassoa, Marcello Mocciad, Serena Ruggierie, Giovanna Borriellof,g, Roberta Lanzillob, Vincenzo Brescia Morrab, Carlo Pozzillia, Maria Petraccaa
Veröffentlichung: Neurotherapeutics 22(2025)e00537
Hinweis: Dieser patientenfreundliche Artikel basiert auf begutachteter Forschung und zielt darauf ab, die ursprünglichen Studienergebnisse korrekt darzustellen und sie für nicht fachkundige Leser zugänglich zu machen.