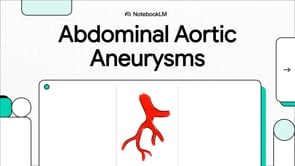Diese umfassende 5-Jahres-Studie belegt anhaltende Vorteile von Ocrelizumab für Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose. Bei frühem Therapiebeginn zeigten sich im Vergleich zu einem Wechsel von einer Interferontherapie eine um 31 % geringere Behinderungsprogression und eine nahezu vollständige Unterdrückung von Hirnläsionen. Das Sicherheitsprofil blieb stabil, ohne neue Bedenken bei Langzeitanwendung.
Fünfjährige Behandlung mit Ocrelizumab bei schubförmiger Multipler Sklerose: Langzeitnutzen und Sicherheit
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Bedeutung dieser Forschung
- Studiendesign und Methoden
- Patientencharakteristika und Teilnahme
- Klinische Ergebnisse: Schubraten und Behinderung
- MRT-Ergebnisse: Läsionsaktivität und Hirnvolumenveränderungen
- Sicherheitsprofil über 5 Jahre
- Bedeutung dieser Ergebnisse für Patienten
- Studienlimitationen
- Empfehlungen für Patienten
- Quelleninformation
Einleitung: Bedeutung dieser Forschung
Multiple Sklerose (MS) ist eine chronische neurologische Erkrankung, bei der das Immunsystem die Schutzschicht der Nervenfasern angreift. Die schubförmige Multiple Sklerose (RMS) ist durch Phasen mit neuen oder sich verschlechternden Symptomen gekennzeichnet, gefolgt von Erholungsphasen. Ocrelizumab ist eine gezielte Therapie, die spezifisch B-Zellen (eine Art von Immunzellen) reduziert, denen eine Schlüsselrolle im Fortschreiten der MS zugeschrieben wird.
Diese Studie begleitete Patienten über fünf Jahre, um die langfristigen Vorteile und die Sicherheit der Ocrelizumab-Behandlung zu untersuchen. Sie verglich Patienten, die frühzeitig mit Ocrelizumab begannen, mit solchen, die nach zwei Jahren von einer Interferontherapie wechselten. Das Verständnis langfristiger Ergebnisse ist entscheidend für Patienten, die Behandlungsentscheidungen treffen, die ihre Lebensqualität über Jahre beeinflussen können.
Studiendesign und Methoden
Die Studie kombinierte Daten aus zwei identischen Phase-III-Studien namens OPERA I und OPERA II. Es handelte sich um randomisierte, doppelblinde Studien, was bedeutet, dass weder Patienten noch Forscher während der initialen Phase wussten, wer welche Behandlung erhielt. Nach der initialen zweijährigen kontrollierten Phase traten die Patienten in eine dreijährige Open-Label-Verlängerungsphase ein, in der alle Teilnehmer Ocrelizumab erhielten.
In den ersten zwei Jahren erhielten die Patienten entweder Ocrelizumab (600 mg Infusionen alle 24 Wochen) oder Interferon beta-1a (44 μg dreimal wöchentlich). Diejenigen, die zu Beginn der Verlängerungsphase von Interferon auf Ocrelizumab wechselten, erhielten ihre erste Dosis als zwei 300 mg Infusionen im Abstand von zwei Wochen. Die Forscher verfolgten mehrere Endpunkte, darunter:
- Jährliche Schubrate (Anzahl der Schübe pro Jahr)
- Über 24 Wochen bestätigte Behinderungsprogression
- Über 24 Wochen bestätigte Verbesserung der Behinderung
- MRT-Aktivität im Gehirn (neue Läsionen und kontrastmittelaufnehmende Läsionen)
- Veränderungen des Gehirnvolumens über die Zeit
- Sicherheitsmaßnahmen und unerwünschte Ereignisse
Die Studie umfasste initial 1.656 Patienten, von denen 1.325 in die Verlängerungsphase eintraten. Der klinische Stichtag für diese Analyse war der 5. Februar 2018, was bis zu fünf Jahre Nachbeobachtungsdaten lieferte.
Patientencharakteristika und Teilnahme
Die Studienteilnehmer waren zwischen den Behandlungsgruppen gut ausbalanciert. Das Durchschnittsalter betrug etwa 37 Jahre, wobei etwa 66 % weiblich waren. Der durchschnittliche Expanded Disability Status Scale (EDSS)-Score lag zu Studienbeginn bei 2,8, was auf eine leichte bis moderate Behinderung hinweist.
Von den 827 Patienten, die ursprünglich mit Ocrelizumab behandelt wurden, traten 702 (84,9 %) in die Verlängerungsphase ein und 623 (75,3 %) schlossen Jahr 5 ab. Von den 829 Patienten, die ursprünglich mit Interferon beta-1a behandelt wurden, traten 623 (75,2 %) in die Verlängerungsphase ein und 551 (66,5 %) schlossen Jahr 5 ab. Insgesamt schlossen 88,6 % der Patienten, die in die Verlängerungsphase eintraten, Jahr 5 ab, was 71 % der ursprünglich eingeschlossenen Population entspricht.
Während der Verlängerungsphase erhielten die Patienten durchschnittlich 7,3–7,4 Dosen Ocrelizumab, ohne signifikanten Unterschied zwischen denen, die Ocrelizumab fortsetzten, und denen, die von Interferon wechselten.
Klinische Ergebnisse: Schubraten und Behinderung
Patienten, die Ocrelizumab fortsetzten, behielten über den Fünfjahreszeitraum niedrige Schubraten bei. Die jährliche Schubrate blieb konstant niedrig:
- Jahr 1: 0,14 Schübe pro Jahr
- Jahr 2: 0,13 Schübe pro Jahr
- Jahr 3: 0,10 Schübe pro Jahr
- Jahr 4: 0,08 Schübe pro Jahr
- Jahr 5: 0,07 Schübe pro Jahr
Patienten, die von Interferon auf Ocrelizumab wechselten, zeigten eine signifikante Reduktion der Schubrate um 52 % (von 0,20 in Jahr 2 auf 0,10 in Jahr 3), die in Jahr 4 und 5 beibehalten wurde (jeweils 0,08 und 0,07). Während der Verlängerungsphase gab es keinen Unterschied in den Schubraten zwischen den beiden Gruppen.
Der kumulative Anteil der Patienten mit über 24 Wochen bestätigter Behinderungsprogression war in der kontinuierlichen Ocrelizumab-Gruppe zu mehreren Zeitpunkten signifikant niedriger:
- Jahr 2: 7,7 % vs 12,0 % (p=0,005)
- Jahr 3: 10,1 % vs 15,6 % (p=0,002)
- Jahr 4: 13,9 % vs 18,1 % (p=0,03)
- Jahr 5: 16,1 % vs 21,3 % (p=0,014)
Dies entspricht einer relativen Reduktion der Behinderungsprogression um 31 % in Jahr 5 für Patienten, die früher mit Ocrelizumab begannen. Die Hazard Ratio für Behinderungsprogression während der initialen Phase betrug 0,60 (95 % KI 0,43–0,84, p=0,003), was ein 40 % geringeres Progressionsrisiko unter Ocrelizumab anzeigt.
Bei der Verbesserung der Behinderung zeigten Patienten unter kontinuierlicher Ocrelizumab-Behandlung numerisch höhere Verbesserungsraten zu allen Zeitpunkten, mit statistischer Signifikanz in Jahr 5 (25,8 % vs 20,6 %, p=0,046).
MRT-Ergebnisse: Läsionsaktivität und Hirnvolumenveränderungen
Die MRT-Ergebnisse zeigten deutliche Unterschiede in der Krankheitsaktivität. Patienten, die Ocrelizumab fortsetzten, behielten eine nahezu vollständige Unterdrückung neuer Hirnläsionen über den Fünfjahreszeitraum bei:
Gadolinium-anreichernde Läsionen (Hinweis auf aktive Entzündung): - Jahr 2: 0,017 Läsionen pro Scan - Jahr 3: 0,005 Läsionen pro Scan - Jahr 4: 0,017 Läsionen pro Scan - Jahr 5: 0,006 Läsionen pro Scan
Neue oder vergrößerte T2-Läsionen (Hinweis auf neue Krankheitsaktivität): - Jahr 2: 0,063 Läsionen pro Scan - Jahr 3: 0,091 Läsionen pro Scan - Jahr 4: 0,080 Läsionen pro Scan - Jahr 5: 0,031 Läsionen pro Scan
Patienten, die von Interferon auf Ocrelizumab wechselten, zeigten nach dem Wechsel eine fast vollständige Unterdrückung der MRT-Aktivität: - Gadolinium-anreichernde Läsionen fielen von 0,491 in Jahr 2 auf 0,007 in Jahr 3 - Neue T2-Läsionen fielen von 2,583 in Jahr 2 auf 0,371 in Jahr 3
Veränderungen des Gehirnvolumens zeigten signifikante Vorteile für die kontinuierliche Ocrelizumab-Behandlung. In Jahr 5 wiesen Patienten unter kontinuierlicher Ocrelizumab-Behandlung signifikant weniger Gehirnvolumenverlust auf im Vergleich zu denen, die von Interferon wechselten: - Gesamtgehirnvolumen: -1,87 % vs -2,15 % (p<0,01) - Graue Substanz: -2,02 % vs -2,25 % (p<0,01) - Weiße Substanz: -1,33 % vs -1,62 % (p<0,01)
Der Anteil der Patienten mit keiner Evidenz für Krankheitsaktivität (NEDA - keine Schübe, Behinderungsprogression oder neue MRT-Läsionen) war in der kontinuierlichen Ocrelizumab-Gruppe sowohl während der initialen Phase (48,5 % vs 27,8 %, p<0,001) als auch über den gesamten Fünfjahreszeitraum (35,7 % vs 19,0 %, p<0,001) signifikant höher.
Sicherheitsprofil über 5 Jahre
Die Sicherheitsanalyse umfasste alle Patienten, die über den Fünfjahreszeitraum mit Ocrelizumab behandelt wurden. Die Gesamtinzidenz unerwünschter Ereignisse war konsistent mit früheren Berichten, und es traten keine neuen Sicherheitssignale bei verlängerter Behandlung auf.
Die häufigsten unerwünschten Ereignisse umfassten: - Infektionen der oberen Atemwege: 47,0 Ereignisse pro 100 Patientenjahre - Harnwegsinfektionen: 16,7 Ereignisse pro 100 Patientenjahre - Nasopharyngitis: 15,5 Ereignisse pro 100 Patientenjahre - Kopfschmerzen: 14,5 Ereignisse pro 100 Patientenjahre
Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse traten mit einer Rate von 10,2 Ereignissen pro 100 Patientenjahre auf. Die häufigsten schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse waren: - Infektionen: 2,6 Ereignisse pro 100 Patientenjahre - Erkrankungen des Nervensystems: 1,4 Ereignisse pro 100 Patientenjahre - Neoplasien: 0,8 Ereignisse pro 100 Patientenjahre
Es gab 12 Todesfälle während der Studie (0,5 Ereignisse pro 100 Patientenjahre), von denen keiner von den Untersuchern als mit Ocrelizumab in Verbindung stehend betrachtet wurde. Die Inzidenz schwerwiegender Infektionen betrug 2,6 Ereignisse pro 100 Patientenjahre, und die Inzidenz von Malignomen betrug 0,8 Ereignisse pro 100 Patientenjahre.
Bedeutung dieser Ergebnisse für Patienten
Diese Fünfjahresstudie liefert starke Evidenz, dass eine frühe und kontinuierliche Behandlung mit Ocrelizumab anhaltende Vorteile für Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose bietet. Die Daten zeigen, dass ein früherer Beginn mit Ocrelizumab zu besseren langfristigen Ergebnissen führt im Vergleich zu einem Beginn mit Interferon und späterem Wechsel.
Patienten, die früher mit Ocrelizumab begannen, zeigten über fünf Jahre signifikant weniger Behinderungsprogression (16,1 % vs 21,3 %), was einer relativen Reduktion von 31 % entspricht. Sie behielten auch eine nahezu vollständige Unterdrückung neuer Hirnläsionen bei und wiesen weniger Gehirnvolumenverlust auf, was wichtig ist, da Hirnatrophie mit langfristiger Behinderung bei MS korreliert.
Das Sicherheitsprofil blieb über fünf Jahre konsistent, ohne dass neue Sicherheitsbedenken auftraten. Dies ist besonders wichtig für Patienten, die langfristige Behandlungsoptionen in Betracht ziehen.
Studienlimitationen
Obwohl diese Studie wertvolle Langzeitdaten liefert, weist sie mehrere Limitationen auf. Die Studie wird als Klasse-III-Evidenz eingestuft, da die initiale Behandlungsrandomisierung nach Eintritt der Patienten in die Verlängerungsphase offengelegt wurde, was potenziell Bias einführen könnte.
Die Verlängerungsphase war Open-Label, was bedeutet, dass sowohl Patienten als auch Ärzte wussten, dass sie Ocrelizumab erhielten, was die Berichterstattung von Ergebnissen beeinflussen könnte. Zusätzlich wurden Patienten, die die Behandlung abbrachen, nicht in die späteren Analysen eingeschlossen, was die Ergebnisse beeinflussen könnte, wenn diejenigen, die abbrachen, unterschiedliche Outcomes hatten.
Die Studie verglich Ocrelizumab mit Interferon beta-1a, das nicht die wirksamste heute verfügbare MS-Therapie ist. Vergleiche mit anderen hochwirksamen Therapien wären für zukünftige Forschung wertvoll.
Empfehlungen für Patienten
Basierend auf dieser Forschung sollten Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose Folgendes in Betracht ziehen:
- Frühe Behandlung mit hochwirksamen Therapien wie Ocrelizumab mit ihrem Neurologen besprechen, da frühere Interventionen bessere langfristige Ergebnisse zu bieten scheinen
- Die langfristigen Vorteile kontinuierlicher Behandlung verstehen, einschließlich reduzierter Behinderungsprogression und weniger neuer Hirnläsionen
- Das Sicherheitsprofil kennen und auf Infektionen während der Behandlung achten
- Regelmäßige Nachsorge mit ihrem Behandlungsteam beibehalten, um das Ansprechen auf die Behandlung und mögliche Nebenwirkungen zu überwachen
- Teilnahme an klinischen Studien in Betracht ziehen, um unser Verständnis langfristiger MS-Behandlungen zu fördern
Patienten sollten offene Gespräche mit ihren Gesundheitsdienstleistern über Behandlungsoptionen führen und dabei sowohl die potenziellen Vorteile als auch Risiken verschiedener Therapien berücksichtigen.
Quelleninformation
Originalartikeltitel: Five years of ocrelizumab in relapsing multiple sclerosis: OPERA studies open-label extension
Autoren: Stephen L. Hauser, MD, Ludwig Kappos, MD, Douglas L. Arnold, MD, Amit Bar-Or, MD, Bruno Brochet, MD, Robert T. Naismith, MD, Anthony Traboulsee, MD, Jerry S. Wolinsky, MD, Shibeshih Belachew, MD, PhD, Harold Koendgen, MD, PhD, Victoria Levesque, PhD, Marianna Manfrini, MD, Fabian Model, PhD, Stanislas Hubeaux, MSc, Lahar Mehta, MD, und Xavier Montalban, MD, PhD
Veröffentlichung: Neurology 2020;95:e1854-e1867. doi:10.1212/WNL.0000000000010376
Klinische Studienkennungen: NCT01247324/NCT01412333
Dieser patientenfreundliche Artikel basiert auf begutachteter Forschung, veröffentlicht in Neurology, dem offiziellen Journal der American Academy of Neurology.