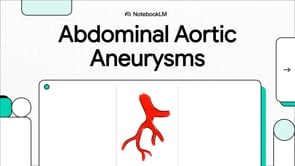In dieser umfassenden Studie wurden 59 Multiple-Sklerose-Patienten untersucht, die aufgrund von Sicherheitsbedenken von Natalizumab auf Anti-CD20-Therapien (Rituximab, Ocrelizumab oder Ofatumumab) umgestellt wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass alle drei Behandlungen wirksam Krankheitsrückfälle verhinderten und stabile Schubraten aufrechterhielten. Dabei wies Rituximab die stärkste Reduktion der jährlichen Schubrate auf (von 0,65 auf 0,08). Bemerkenswert ist, dass 70 % der Behinderungsprogression auf eine von Schubaktivität unabhängige Progression (PIRA) zurückgingen. Dies unterstreicht die anhaltende Herausforderung, die schleichende Erkrankung selbst unter wirksamen Therapien zu behandeln.
Anti-CD20-Therapien nach Natalizumab bei Multipler Sklerose: Ein Überblick
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Relevanz der Studie
- Methodik: Studiendesign und Durchführung
- Ergebnisse im Detail
- Klinische Bedeutung
- Studienlimitationen
- Empfehlungen für Patienten
- Quellenangaben
Einleitung: Relevanz der Studie
Multiple Sklerose (MS) ist eine chronische neurologische Erkrankung, bei der das Immunsystem die Schutzschicht der Nervenfasern angreift. In den letzten zehn Jahren wurden erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung krankheitsmodifizierender Therapien (KMT) erzielt, die das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen und Schübe reduzieren können.
Natalizumab (Handelsname Tysabri) zählt zu diesen hochwirksamen Behandlungen, birgt jedoch das Risiko einer progressiven multifokalen Leukenzephalopathie (PML) – einer seltenen, durch das JC-Virus verursachten Gehirninfektion. Bei JCV-Positivität oder anderen Sicherheitsbedenken wird ein Therapiewechsel erforderlich.
Diese Studie untersuchte drei Anti-CD20-Therapien, die gezielt Immunzellen angreifen: Rituximab (häufig Off-Label bei MS eingesetzt), Ocrelizumab (Ocrevus) und Ofatumumab (Kesimpta). Untersucht wurde, wie wirksam diese Behandlungen nach Natalizumab-Absetzen sind, insbesondere ob sie Rebound-Phänomene verhindern und die Krankheitsstabilität erhalten.
Methodik: Studiendesign und Durchführung
Es handelte sich um eine retrospektive Studie, bei der Krankenakten von Patienten ausgewertet wurden, die bereits einen Therapiewechsel vorgenommen hatten. Eingeschlossen wurden 59 Patienten eines portugiesischen Zentrums, die folgende Kriterien erfüllten:
- Gesicherte MS-Diagnose nach McDonald-Kriterien 2017
- Mindestens 18 Jahre alt
- Wechsel von Natalizumab auf eine der drei Anti-CD20-Therapien
- Mindestens sechsmonatige Behandlung mit der neuen Therapie
Erhoben wurden:
- Demografische Daten (Alter, Geschlecht)
- Klinische Merkmale (Erkrankungstyp, -dauer)
- Behandlungsverlauf (Natalizumab-Dauer, Wechselgründe)
- Outcomes: jährliche Schubrate (ARR), EDSS-Wert und Behinderungsprogression
Die Auswertung erfolgte mit robusten statistischen Methoden. Die Nachbeobachtungszeit betrug im Mittel 28,58 Monate nach Therapiewechsel.
Ergebnisse im Detail
Von den 59 Patienten wechselten 23 (39 %) zu Rituximab, 29 (49,2 %) zu Ocrelizumab und 7 (11,9 %) zu Ofatumumab. 69,5 % waren Frauen, 91,5 % hatten eine schubförmig remittierende MS (RRMS).
Demografische Unterschiede zwischen den Gruppen:
- Rituximab-Patienten hatten eine längere Erkrankungsdauer (11,0 Jahre) vs. Ocrelizumab (5,79 Jahre) und Ofatumumab (6,29 Jahre)
- Rituximab-Patienten wiesen höhere Schubraten auf (ARR 0,65) vs. Ocrelizumab (ARR 0,03) und Ofatumumab (ARR 0)
- Rituximab-Patienten hatten höhere EDSS-Werte (3,65) vs. Ocrelizumab (2,4) und Ofatumumab (2)
Wirksamkeit:
Unter Rituximab sank die ARR signifikant von 0,65 auf 0,08 (p=0,007). Allerdings stieg der EDSS-Wert von 3,65 auf 4,15 (p=0,022).
Ocrelizumab und Ofatumumab zeigten keine signifikanten Veränderungen bei ARR oder EDSS. Ocrelizumab-Patienten blieben stabil (ARR 0,03 zu 0,07, p=0,285; EDSS 2,40 zu 2,52, p=0,058). Unter Ofatumumab traten keine Schübe auf; der EDSS-Wert blieb stabil (2,00 zu 2,14, p=0,317).
Behinderungsprogression:
10 Patienten (16,9 %) erlebten eine Behinderungsprogression. 70 % davon wurden als PIRA (Progression unabhängig von Schubaktivität) klassifiziert – also ohne Schübe oder neue MRT-Läsionen.
Sicherheit und Therapiewechsel:
13 Patienten (22 %) wechselten erneut die Therapie. Gründe:
- Unwirksamkeit (8 Patienten) – aufgrund von Schüben, MRT-Aktivität oder klinischer Progression
- Sicherheitsbedenken (3 Patienten) – z.B. wiederkehrende Infektionen
- Nebenwirkungen (2 Patienten) – vorwiegend Infektionen
Für Ofatumumab wurden keine relevanten Sicherheitsprobleme berichtet.
Klinische Bedeutung
Die Studie zeigt: Alle drei Anti-CD20-Therapien sind wirksame Optionen nach Natalizumab. Ein Krankheitsrebound trat nicht auf.
Besonders relevant ist der hohe Anteil von PIRA (70 % der Behinderungsprogressionen). Selbst bei erfolgreicher Schubkontrolle kann also eine zugrundeliegende Progression fortschreiten. Dies unterstreicht die Notwendigkeit von Therapien, die sowohl entzündliche als auch progressive Krankheitsaspekte adressieren.
Für einen Wechsel von Natalizumab bieten Anti-CD20-Therapien einen sicheren Übergang bei erhaltener Krankheitskontrolle. Die Wahl des Präparats sollte individuell erfolgen – unter Berücksichtigung von Erkrankungsdauer, Aktivitätsniveau sowie Präferenzen bzgl. Applikation und Nebenwirkungen.
Studienlimitationen
Bei der Interpretation sind folgende Einschränkungen zu beachten:
Die Stichprobe war klein, besonders in der Ofatumumab-Gruppe (n=7). Die Gruppen waren zu Studienbeginn nicht vergleichbar: Rituximab-Patienten hatten eine längere Erkrankungsdauer und höhere Aktivität, was die Ergebnisse beeinflusst haben könnte. Ein direkter Vergleich der Wirksamkeit ist daher nicht möglich.
Die Nachbeobachtungszeit variierte: Ofatumumab im Mittel 6,86 Monate vs. Rituximab 48,57 und Ocrelizumab 17,97 Monate. Längere Beobachtung könnte andere Ergebnisse zeigen.
Als retrospektive Studie konnte nicht für alle Störfaktoren kontrolliert werden. Randomisierte Studien wären aussagekräftiger, aber in dieser Patientengruppe schwerer umsetzbar.
Empfehlungen für Patienten
Für Patienten und Behandler ergeben sich folgende Handlungsempfehlungen:
- Anti-CD20-Therapien besprechen bei geplantem Natalizumab-Absetzen. Sie verhindern einen Rebound wirksam.
- Behinderungsprogression auch ohne Schübe beachten. Regelmäßige Kontrollen der Behinderung bleiben wichtig.
- Individuelle Krankengeschichte berücksichtigen. Patienten mit längerer Erkrankungsdauer und höherer Behinderung können anders reagieren.
- Regelmäßige Nachsorge wahrnehmen. 13 Patienten wechselten aufgrund von Unwirksamkeit oder Nebenwirkungen – fortlaufende Überwachung ist essenziell.
- Progressive Krankheitsaspekte ansprechen. Die hohe PIRA-Rate zeigt: Die zugrundeliegende Progression erfordert besondere Aufmerksamkeit.
Quellenangaben
Originaltitel: Wirksamkeit von Anti-CD20-Therapien nach Natalizumab-Absetzen: Einblicke aus einer Kohortenstudie
Autoren: Carolina Cunha, Sara Matos, Catarina Bernardes, Inês Carvalho, João Cardoso, Isabel Campelo, Carla Nunes, Carmo Macário, Lívia Sousa, Sónia Batista, Inês Correia
Veröffentlichung: Multiple Sclerosis and Related Disorders, Band 101, 2025, 106564
Hinweis: Dieser patientenfreundliche Artikel basiert auf einer peer-reviewten Studie. Er fasst die wesentlichen Ergebnisse verständlich zusammen, behält aber alle relevanten Daten bei.