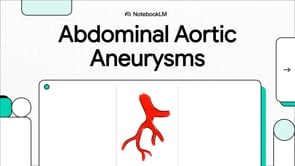Dieser Fallbericht schildert den Krankheitsverlauf einer 19-jährigen Patientin, die plötzlich Krampfanfälle, Sprachstörungen und psychiatrische Symptome entwickelte. Nach umfangreichen Untersuchungen und mehreren Klinikaufenthalten diagnostizierten die Ärzte bei ihr eine Anti-NMDA-Rezeptor-Enzephalitis – eine seltene Autoimmunerkrankung, bei der der Körper Gehirnzellen angreift. Die Diagnose wurde durch ein Ovarialteratom (eine Art Tumor) ausgelöst. Ihre Symptome besserten sich nach der Tumorentfernung und einer anschließenden Immuntherapie deutlich.
Anti-NMDA-Rezeptor-Enzephalitis: Eine medizinische Detektivgeschichte
Inhaltsverzeichnis
- Fallvorstellung: Plötzliches Auftreten von Symptomen
- Klinischer Verlauf und Untersuchungen
- Differenzialdiagnose: Abwägung aller Möglichkeiten
- Diagnose und Therapie
- Pathologische Befunde: Ursachenbestätigung
- Klinische Bedeutung für Patientinnen
- Diagnostische Herausforderungen
- Empfehlungen für Betroffene
- Quellen
Fallvorstellung: Plötzliches Auftreten von Symptomen
Eine bis dahin gesunde 19-Jährige wurde nach zehntägigen, besorgniserregenden Symptomen im Massachusetts General Hospital aufgenommen. Ihre Beschwerden begannen mit verlangsamter Sprache sowie zeitweiligem Zittern und Taubheitsgefühl im rechten Arm. Sieben Tage vor der Aufnahme brachen Passanten sie mit generalisiertem Zittern auf einer U-Bahn-Plattform zusammen.
Bei Eintreffen des Rettungsdienstes war sie verwirrt, sabberte und hatte sich auf die Zunge gebissen. Während des Transports in die Notaufnahme eines anderen Krankenhauses kam sie allmählich wieder zu sich, erinnerte sich jedoch nicht an den Vorfall. Die ersten Vitalzeichen und die körperliche Untersuchung waren unauffällig, aber Blutuntersuchungen zeigten erhöhte Laktatwerte von 13,9 mmol/L (Norm: 0,7–2,1 mmol/L) und eine Kreatinkinase von 84 U/L (Norm: 30–135 U/L).
Weitere Blutwerte – einschließlich Elektrolyte, Glukose, Leberenzyme, Nierenfunktion und Blutbild – waren normal. Bildgebende Verfahren des Gehirns (sowohl CT als auch MRT ohne Kontrastmittel) ergaben keine Auffälligkeiten. Trotzdem wurde sie zur weiteren Beobachtung stationär aufgenommen.
Klinischer Verlauf und Untersuchungen
Am ersten Krankenhaustag erlebte die Patientin drei Episoden plötzlicher, intensiver Angst und Beklemmung, jeweils gefolgt von generalisiertem Zittern über 60–90 Sekunden. Während der dritten Episode setzte die Atmung aus, die Sauerstoffsättigung sank auf 50 %. Das medizinische Personal verabreichte Sauerstoff und begann eine Behandlung mit intravenösem Lorazepam und Levetiracetam (Antiepileptika).
Am zweiten Tag wurde Lamotrigin (ein weiteres Antiepileptikum) hinzugefügt. Sie hatte weiterhin Episoden von stockender Sprache. Ein am dritten Tag durchgeführtes EEG zeigte keine Hinweise auf epileptische Aktivität. Am fünften Tag wurde sie mit der Empfehlung entlassen, die Antiepileptika fortzusetzen und neurologisch nachbeobachten zu lassen.
Auf dem Heimweg bemerkten ihre Eltern rhythmische Mundbewegungen und Zittern des rechten Arms. Auf Ansprache reagierte sie nicht, starrte nur leer. Sie kehrten in die Notaufnahme zurück, wo sie nicht sprechen, aber über ihr Telefon tippen konnte. Erneute Aufnahme: intermittierende Stummheit und rechtsseitige Zuckungen. Ein weiteres EEG war normal, nach drei Tagen erneute Entlassung.
Einen Tag später bestanden die Symptome fort: Taubheit im rechten Arm, Zuckungen, zeitweise Stummheit. Ihre Eltern brachten sie zur Abklärung in die Notaufnahme des Massachusetts General Hospital.
Differenzialdiagnose: Abwägung aller Möglichkeiten
Das medizinische Team gliederte die Symptome in drei Kategorien: anfallsartige Aktivität, Katatonie (Bewegungs- und Verhaltensstörung) und psychotische Symptome. Der initiale Kollaps mit Zittern, Verwirrtheit und erhöhten Laktatwerten sprach für generalisierte Anfälle. Die rechtsseitigen Symptome und Angstgefühle passten zu fokalen Anfällen aus dem linken Parietallappen.
Mehrere Faktoren passten jedoch nicht zu typischen Anfallserkrankungen: Die Symptome bestanden trotz Antiepileptika fort, EEGs blieben unauffällig. Ihre bizarren Verhaltensweisen, wechselnden Sprachmuster und Stummheit ließen an Katatonie denken. Desorganisiertes Denken und mentale Fragmentierung deuteten auf psychotische Symptome hin.
Systematisch wurden zahlreiche Möglichkeiten erwogen und ausgeschlossen:
- Substanzinduzierte Psychose: Unwahrscheinlich bei anhaltenden Symptomen im Krankenhaus
- Infektionen: HSV, Lyme-Borreliose, Tuberkulose, Neurozystizerkose – alle tests negativ
- Autoimmunerkrankungen: Multiple Sklerose, Lupus, Vaskulitis – unwahrscheinlich bei normaler Bildgebung
- Stoffwechselstörungen: Normale Blutwerte schlossen die meisten aus
- Genetische Erkrankungen: Morbus Wilson ohne Lebersymptome unwahrscheinlich
Der Fokus lag schließlich auf autoimmunen Enzephalitiden, insbesondere Anti-NMDA-Rezeptor-Enzephalitis, die bei jungen Frauen oft mit psychiatrischen Symptomen, Anfällen und Bewegungsstörungen einhergeht. Diese Erkrankung ist häufig mit Ovarialteratomen assoziiert und zeigt oft normale MRT-Befunde (in bis zu 50 % der Fälle).
Diagnose und Therapie
Unter Verdacht auf Anti-NMDA-Rezeptor-Enzephalitis wurde eine Lumbalpunktion durchgeführt: 19 weiße Blutkörperchen/µl (Norm: 0–5) mit 89 % Lymphozyten – Hinweis auf Entzündung im ZNS. Liquor-Glukose und -Protein waren normal.
Am dritten Tag begann eine empirische Therapie mit intravenösem Methylprednisolon (Steroid), am sechsten Tag folgte intravenöses Immunglobulin (IVIG). Diese immunsuppressive Behandlung zielt darauf ab, die Antikörper gegen NMDA-Rezeptoren im Gehirn zu reduzieren. Bildgebung zeigte eine 17 cm große Ovarialmasse mit Fett, Verkalkungen und Weichteilgewebe – passend zu einem immaturen Teratom.
Am siebten Tag erfolgte die operative Entfernung des linken Eierstocks und Eileiters (Salpingo-Ovarektomie) sowie eine Zystenentfernung am rechten Eierstock. Die Pathologie bestätigte die Diagnose: immature Teratomgewebe mit primitiven neuroepithelialen Anteilen.
Pathologische Befunde: Ursachenbestätigung
Der linke Eierstock maß 16,5 cm und enthielt ausgereiftes Gewebe aller drei Keimblätter (Ektoderm, Mesoderm, Endoderm) – typisch für Teratome. Entscheidend: immature neuroepitheliale Gewebe machten etwa 70 % des Tumors aus, mit primitiven Zellen und lebhafter mitotischer Aktivität.
Zusätzlich fanden sich Anteile eines Dottersacktumors (ca. 30 % des Volumens). Die immunhistochemische Färbung für Glypican-3 war in beiden Komponenten positiv. Am elften Tag bestätigte die Serumuntersuchung Antikörper gegen die Glutamat-NR1-Untereinheit der NMDA-Rezeptoren – definitive Diagnosesicherung.
Klinische Bedeutung für Patientinnen
Dieser Fall zeigt mehrere wichtige Punkte: Die Anti-NMDA-Rezeptor-Enzephalitis betrifft typischerweise junge Frauen mit psychiatrischen Symptomen, Anfällen, Bewegungsstörungen und kognitiven Veränderungen. Oft wird sie zunächst mit primär psychiatischen Erkrankungen verwechselt; neurologische Symptome sollten jedoch an autoimmune Ursachen denken lassen.
Frühe Diagnose und Behandlung sind entscheidend. Die Erkrankung ist häufig mit Ovarialteratomen assoziiert (bei ca. 50 % der jungen Frauen), weshalb eine Beckenbildgebung essenziell ist. Die Therapie umfasst Immuntherapie (Sterioide, IVIG) und Tumorentfernung, was oft zu deutlicher Besserung führt.
Die Erholung kann sich über Monate bis Jahre hinziehen und umfangreiche Rehabilitation erfordern. Bei adäquater Behandlung erreichen jedoch etwa 80 % der Patientinnen eine gute funktionelle Erholung, auch wenn residuale kognitive oder Verhaltensprobleme bleiben können.
Diagnostische Herausforderungen
Dieser Fall zeigt mehrere Schwierigkeiten: Initial normale EEG- und MRT-Befunde verzögerten die Diagnose, da diese Tests bei früher Anti-NMDA-Rezeptor-Enzephalitis oft unauffällig sind. Psychiatrische Symptome überlagerten zunächst die neurologischen Aspekte.
Die Antikörpertestung dauert 7–10 Tage – in dieser Zeit müssen Behandlungsentscheidungen auf klinischem Verdacht basieren. Hier konnte die Liquor-Untersuchung auf Antikörper nicht abgeschlossen werden, die Serumtestung reichte jedoch aus.
Die Symptomprogression – von anfallsartiger Aktivität zu Bewegungsstörungen und psychiatrischen Symptomen – ist charakteristisch, wird aber oft als separate Erkrankungen fehlinterpretiert.
Empfehlungen für Betroffene
Für Patientinnen und Familien mit ähnlichen Symptomen:
- Umfassende Abklärung bei gleichzeitig neurologischen und psychiatrischen Symptomen, besonders bei jungen Frauen
- Beharrlich bleiben, wenn initiale Tests normal sind, Symptome aber fortbestehen
- Autoimmune Enzephalitis als Ursache komplexer neuropsychiatrischer Symptome in Betracht ziehen
- Vollständige Diagnostik einschließlich Beckenbildgebung bei Verdacht auf autoimmune Enzephalitis
- Geduld haben: Erholung braucht Zeit und erfordert oft multiple Spezialisten
Dieser Fall unterstreicht die Bedeutung autoimmuner Ursachen bei neuropsychiatrischen Symptomen und die kritische Rolle von Ovarialteratomen bei Anti-NMDA-Rezeptor-Enzephalitis. Frühe Tumorentfernung plus Immuntherapie bietet die beste Prognose.
Quellen
Originaltitel: Fall 22-2025: Eine 19-jährige Frau mit anfallsartiger Aktivität und seltsamen Verhaltensweisen
Autoren: Judith A. Restrepo, M.D., Amirkasra Mojtahed, M.D., Leah W. Morelli, M.D., Nagagopal Venna, M.D., Gulisa Turashvili, M.D., Ph.D.
Publikation: The New England Journal of Medicine, 31. Juli 2025, Band 393, Seiten 488–496
DOI: 10.1056/NEJMcpc2412531
Dieser patientenfreundliche Artikel basiert auf einer peer-reviewten Fallstudie des Massachusetts General Hospital.