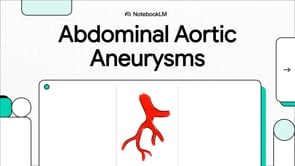Primärer Hyperparathyreoidismus ist eine Erkrankung, bei der überaktive Nebenschilddrüsen zu erhöhten Kalziumwerten im Blut führen. Sie tritt bei etwa 23 von 10.000 Frauen und 8,5 von 10.000 Männern auf. Diese Übersichtsarbeit zeigt, dass viele Patienten zwar nur milde Symptome haben, jedoch ein erhöhtes Risiko für Nierensteine, Knochenschwund und Frakturen besteht. Die chirurgische Entfernung veränderter Drüsen ist die definitive Therapie und wird insbesondere Patienten unter 50 Jahren sowie bei ausgeprägtem Knochenverlust, Nierensteinen oder stark erhöhten Kalziumwerten empfohlen. Bei nicht-operablen Patienten kann eine medikamentöse Behandlung mit Kalzium- und Vitamin-D-Supplementierung zur Symptomkontrolle beitragen.
Primärer Hyperparathyreoidismus verstehen: Ein Patientenleitfaden zu Diagnose und Behandlung
Inhaltsverzeichnis
- Das klinische Problem
- Symptome und klinisches Bild
- Mögliche Komplikationen
- Diagnose und Abklärung
- Operative Behandlungsoptionen
- Medikamentöse Therapieansätze
- Klinische Empfehlungen
- Wichtige Einschränkungen
- Quelleninformation
Das klinische Problem
Primärer Hyperparathyreoidismus entsteht, wenn eine oder mehrere der vier Nebenschilddrüsen überaktiv werden und zu viel Parathormon (PTH) produzieren. Dadurch steigt der Kalziumspiegel im Blut. In Gesundheitssystemen mit routinemäßigen Blutuntersuchungen wird bei den meisten Betroffenen eine leichte bis mittelschwere Hyperkalzämie (erhöhter Blutkalziumspiegel) zusammen mit unangemessen normalen oder erhöhten PTH-Werten festgestellt.
Die Erkrankung tritt bei Frauen häufiger auf als bei Männern, mit einer geschätzten Inzidenz von 66 Fällen pro 100.000 Personenjahre bei Frauen gegenüber 25 pro 100.000 bei Männern. Etwa 50 % der Patienten mit leichter bis mittelschwerer Hyperkalzämie werden operiert, und Studien zeigen, dass 30–40 % der übrigen Patienten innerhalb von 15 Jahren Nachbeobachtungszeit ebenfalls eine Operation benötigen.
Rund 80 % der Patienten haben ein einzelnes Nebenschilddrüsenadenom (gutartiger Tumor), während 10–11 % multiple Adenome aufweisen. Weniger als 10 % leiden unter einer Hyperplasie aller vier Drüsen, und ein Nebenschilddrüsenkarzinom verursacht weniger als 1 % der Fälle. Das klinische Bild variiert erheblich je nach verfügbaren Gesundheitsressourcen; Patienten in ressourcenarmen Umgebungen weisen typischerweise fortgeschrittenere Krankheitsstadien auf.
Symptome und klinisches Bild
In gut ausgestatteten Gesundheitssystemen zeigen weniger als 20 % der Patienten deutliche Symptome. Falls Beschwerden auftreten, können diese umfassen:
- Müdigkeit und allgemeine Schwäche
- Depression und Angstzustände
- Gedächtnisprobleme und Konzentrationsschwierigkeiten
- Verstopfung (besonders bei mittelschwerer bis schwerer Hyperkalzämie)
- Knochenschmerzen oder Frakturen
- Nierensteine und Nierenkoliken (Schmerzen durch Steine, die den Harnleiter passieren)
Schwere Symptome wie Bewusstseinstrübung (verminderte Wachheit) oder erhebliche neuromuskuläre Schwäche sind sehr selten und meist mit großen Adenomen oder Nebenschilddrüsenkrebs verbunden. Aufgrund der hohen Kalziumspiegel können Patienten auch vermehrten Durst und häufiges Wasserlassen verspüren.
Zwar berichten viele Patienten über neuropsychiatrische Symptome, ein direkter kausaler Zusammenhang mit der Nebenschilddrüsenerkrankung bleibt jedoch ungewiss. Dehydrierung oder Immobilität können die Hyperkalzämie verschlimmern, daher ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr für Betroffene besonders wichtig.
Mögliche Komplikationen
Unbehandelt kann der primäre Hyperparathyreoidismus zu mehreren schwerwiegenden Komplikationen führen. Die bedeutendsten Probleme betreffen Knochen und Nieren.
Knochenverlust und Frakturrisiko
Die Skelettgesundheit wird durch Hyperparathyreoidismus erheblich beeinträchtigt. Studien zeigen, dass 23 % der Patienten Knochendichtewerte im Femur von weniger als 80 % des Normalwerts aufweisen, während 58 % eine reduzierte Knochendichte im Radius im Vergleich zu gesunden Gleichaltrigen haben. Eine andere Studie ergab, dass 15 % der Patienten eine Osteopenie in der Lendenwirbelsäule aufwiesen.
Eine neuere Untersuchung mit 4.016 Patienten, die sich Knochendichtemessungen unterzogen, zeigte, dass 451 eine signifikant niedrige Knochenmineraldichte hatten; davon litten 52 Patienten (12 %) an primärem Hyperparathyreoidismus. Dies deutet darauf hin, dass die Erkrankung bei Menschen mit niedriger Knochendichte häufiger vorkommt als bisher angenommen.
Die Knochenmasse nimmt bei Hyperparathyreoidismus-Patienten typischerweise langsam ab. Während einer 15-jährigen Beobachtungsstudie blieb die spinale Knochenmineraldichte erhalten, während die Dichte im Femurhals und Radius allmählich abnahm. Wichtig ist, dass Studien ein erhöhtes Frakturrisiko in der Wirbelsäule, am Handgelenk, an den Rippen und im Becken belegen. Das Risiko für Hüftfrakturen könnte ebenfalls erhöht sein, obwohl die Evidenz hier weniger eindeutig ist.
Nierensteine und renale Komplikationen
Symptomatische Nierensteinerkrankungen sind in gut ausgestatteten Gesundheitssystemen seltener als früher, bleiben aber ein bedeutendes Problem. Eine US-Studie ergab, dass 3 % von 1.190 Erwachsenen, die auf Nierensteine untersucht wurden, einen Hyperparathyreoidismus hatten. Die geschätzte Prävalenz radiologisch identifizierter Nierensteine bei Hyperparathyreoidismus-Patienten liegt zwischen 7 und 20 %.
Betroffene mit Hyperparathyreoidismus und Nierensteinen neigen zu höheren 24-Stunden-Urinkalziumwerten und höheren Serum-1,25-Dihydroxyvitamin-D-Spiegeln im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung mit Steinen. Weitere Risikofaktoren umfassen Hypozitraturie (niedriger Zitratgehalt im Urin) und Hyperoxalurie (hoher Oxalatgehalt im Urin). Die Art der Steine ist ebenfalls relevant – Patienten mit gemischten Kalziumoxalat-Apatit-Steinen oder reinen Apatit-Steinen haben häufiger einen Hyperparathyreoidismus.
Kardiovaskuläre und neuropsychiatrische Bedenken
Patienten mit primärem Hyperparathyreoidismus können erhöhte Raten von Hypertonie, Veränderungen der linksventrikulären Masse und Funktion sowie andere nachteilige kardiale Veränderungen aufweisen. Beobachtungsstudien berichten von erhöhten Risiken für Gesamtsterblichkeit und speziell für kardiovaskuläre Todesfälle.
Depression, Angstzustände und kognitive Schwierigkeiten werden häufig beschrieben, obwohl der genaue Zusammenhang mit der Nebenschilddrüsenerkrankung unklar bleibt. Einige Studien deuten darauf hin, dass diese Symptome nach erfolgreicher Behandlung abnehmen können, die Evidenz ist jedoch nicht einheitlich.
Diagnose und Abklärung
Die Diagnose des primären Hyperparathyreoidismus basiert auf dem Nachweis erhöhter Blutkalziumspiegel bei unangemessen normalen oder hohen Parathormonwerten. Ihr Arzt wird typischerweise mehrere Tests anordnen, um die Diagnose zu bestätigen und Komplikationen zu beurteilen.
Die Abklärung sollte umfassen:
- Serumkalziumspiegel (üblicherweise erhöht)
- Intaktes Parathormon (iPTH)-Spiegel (unangemessen normal oder hoch)
- 25-Hydroxyvitamin-D-Spiegel (üblicherweise normal oder niedrig-normal)
- Glomeruläre Filtrationsrate (Nierenfunktion)
- 24-Stunden-Urinkalziumausscheidung
- Knochendichtemessung (einschließlich des distalen Drittels des Radius)
- Nierenultraschall zum Nachweis von Steinen bei klinischem Verdacht
Es ist wichtig, den primären Hyperparathyreoidismus von anderen Erkrankungen zu unterscheiden, die hohe PTH-Spiegel verursachen können, einschließlich:
- Sekundärer Hyperparathyreoidismus (Reaktion auf niedriges Kalzium aufgrund von Vitamin-D-Mangel oder Nierenerkrankung)
- Familiäre hypokalziurische Hyperkalzämie (eine genetische Erkrankung, die üblicherweise keine Behandlung erfordert)
- Genetische Syndrome wie multiple endokrine Neoplasie Typ 1 und 2
- Medikamenteneffekte (Langzeit-Lithiumtherapie kann ähnliche Befunde verursachen)
Operative Behandlungsoptionen
Die Operation bleibt die einzige definitive Behandlung des primären Hyperparathyreoidismus. Aktuelle Leitlinien empfehlen einen Eingriff für:
- Patienten jünger als 50 Jahre
- Diejenigen mit Serumkalziumwerten mehr als 1,0 mg/dL über der oberen Normgrenze
- Postmenopausale Frauen und Männer über 50 mit Knochendichte-T-Scores von -2,5 oder niedriger an zentralen Stellen oder dem distalen Radius
- Patienten, die kürzlich eine Fragilitätsfraktur erlitten haben
- Diejenigen mit glomerulärer Filtrationsrate unter 60 mL/Minute
- Patienten mit Nierensteinen
- Diejenigen mit 24-Stunden-Urinkalzium über 400 mg/Tag
Mehrere Bildgebungsverfahren helfen Chirurgen, abnormales Nebenschilddrüsengewebe vor der Operation zu lokalisieren:
| Bildgebungsmethode | Sensitivität | Positiver prädiktiver Wert | Eigenschaften |
|---|---|---|---|
| Sonographie | 70,4–81,4 % | 90,7–95,3 % | Sicher, keine Strahlung; kann mediastinale Adenome nicht erfassen |
| Technetium-99m-Sestamibi-Szintigraphie | 64–90,6 % | 83,5–96,0 % | Hilft bei der Detektion von ektopischem Gewebe |
| Dynamische (4D) CT-Bildgebung | 89,4 % | 93,5 % | Nützlich für multiple oder ektopische Adenome; beinhaltet Strahlung |
| Magnetresonanztomographie | 88 % | 90 % | Gleich wie CT aber keine Strahlungsbedenken |
Während der Operation verwenden Chirurgen oft intraoperative PTH-Messungen, um zu bestätigen, dass alles abnormale Gewebe entfernt wurde. Der PTH-Spiegel sollte nach Entfernung der betroffenen Drüse(n) um mindestens 50 % abfallen und in den Normalbereich gelangen. In Expertenzentren liegen die Heilungsraten über 95 %.
Mögliche Komplikationen umfassen Verletzungen des Nervus laryngeus recurrens (Beeinträchtigung der Stimme, tritt in weniger als 1 % der Fälle auf), Wundinfektion, Blutung und temporäre Hypokalzämie (niedriges Kalzium), die in 15–30 % der Fälle auftritt. Temporäre Hypokalzämie kann üblicherweise mit Calcitriol und Kalziumpräparaten behandelt werden.
Medikamentöse Therapieansätze
Für Patienten, die nicht operiert werden können oder sich gegen eine Operation entscheiden, können mehrere medikamentöse Ansätze helfen, die Erkrankung zu managen. Überwachungsempfehlungen umfassen jährliche Serumkalziummessungen und Knochendichtemessungen alle 1–2 Jahre.
Medikamentöse Therapien konzentrieren sich auf drei Hauptbereiche:
Behandlung der Hyperkalzämie
Cinacalcet ist ein Medikament, das die Serumkalziumspiegel senken kann, indem es die Empfindlichkeit der Kalzium-sensierenden Rezeptoren erhöht. Es verhindert jedoch nicht den Knochenverlust oder reduziert das Frakturrisiko. Es wird primär bei Patienten mit signifikanter Hyperkalzämie eingesetzt, die nicht für eine Operation in Frage kommen.
Management der Knochenerkrankung
Bisphosphonate können die Knochendichte bei Patienten mit Hyperparathyreoidismus verbessern, aber ob sie tatsächlich das Frakturrisiko reduzieren, bleibt unbekannt. Diese Medikamente werden üblicherweise vorsichtig eingesetzt, da die Knochendichte oft nach erfolgreicher Operation allein signifikant ansteigt.
Studien zeigen, dass die chirurgische Heilung üblicherweise zu 2–4 %igen Zunahmen der Knochenmasse im ersten postoperativen Jahr führt. Daher warten Ärzte außer in schweren Fällen üblicherweise ab, wie viel Knochenmasse sich nach der Operation natürlich verbessert, bevor sie antiosteoporotische Medikamente beginnen.
Ernährungsunterstützung
Die Behandlung von Vitamin-D- und Kalziummangel ist entscheidend, da diese Mängel den Hyperparathyreoidismus verschlimmern können. Die Supplementierung muss jedoch unter ärztlicher Aufsicht sorgfältig gemanagt werden, um eine Verschlimmerung der Hyperkalzämie oder Hyperkalziurie (überschüssiges Kalzium im Urin) zu vermeiden.
Patienten sollten eine angemessene, aber nicht excessive Kalziumzufuhr aufrechterhalten (üblicherweise 1000–1200 mg/Tag aus allen Quellen) und ausreichende Vitamin-D-Spiegel sicherstellen (Ziel 25-Hydroxyvitamin-D über 20 ng/mL).
Klinische Empfehlungen
Basierend auf der aktuellen Evidenz sind hier die wichtigsten Empfehlungen für Patienten mit primärem Hyperparathyreoidismus:
- Vollständige umfassende Abklärung inklusive Kalzium-, Parathormon- (PTH)- und Vitamin-D-Spiegel, Nierenfunktionstests, 24-Stunden-Sammelurin auf Kalzium, Knochendichtemessung (inklusive Unterarm) sowie Nierensonographie bei Steinbeschwerden
-
Chirurgische Vorstellung erwägen bei Erfüllung eines dieser Kriterien:
- Alter unter 50 Jahren
- Kalziumspiegel >1,0 mg/dL über dem Normbereich
- Knochendichte-T-Score ≤ -2,5 an Wirbelsäule, Hüfte oder Unterarm
- Anamnese einer Fragilitätsfraktur
- Nierensteine
- 24-Stunden-Urinkalzium >400 mg/Tag
- Eingeschränkte Nierenfunktion (GFR <60 mL/Minute)
-
Für nicht-operable Patienten sollte die medikamentöse Behandlung umfassen:
- Regelmäßige Kontrolle von Kalziumspiegel und Knochendichte
- Ausgleich von Vitamin-D- und Kalziumdefiziten
- Erwägung von Cinacalcet bei ausgeprägter Hyperkalzämie
- Mögliche Bisphosphonat-Therapie bei Osteoporose
-
Lebensstilmodifikationen einschließlich:
- Ausreichende Flüssigkeitszufuhr
- Mäßige Kalziumaufnahme (1000–1200 mg/Tag)
- Adäquate Vitamin-D-Supplementierung zur Aufrechterhaltung von Spiegeln >20 ng/mL
- Regelmäßige belastende Bewegung zur Unterstützung der Knochengesundheit
Wichtige Einschränkungen
Obwohl für viele Aspekte der Hyperparathyreoidismus-Behandlung gute Evidenz besteht, bleiben mehrere wichtige Fragen ungeklärt:
Der Zusammenhang zwischen Hyperparathyreoidismus und neuropsychiatrischen Symptomen ist weiterhin ungewiss. Randomisierte kontrollierte Studien zeigten keine konsistenten Verbesserungen kognitiver und emotionaler Symptome nach chirurgischer Heilung, obwohl einige Patienten subjektive Besserung berichten.
Ebenso bleibt unklar, ob eine Operation die kardiovaskulären Risiken bei Hyperparathyreoidismus reduziert. Beobachtungsstudien und Nachuntersuchungen randomisierter Studien ergaben keine signifikante Verbesserung von Blutdruck oder metabolischen Markern nach dem Eingriff, mit höchstens moderaten Veränderungen der Herzfunktionsparameter.
Die Langzeitvorteile einer medikamentösen versus chirurgischen Behandlung werden weiter untersucht, insbesondere bei Patienten mit milder Erkrankung. Die Entscheidung zwischen Operation und Überwachung sollte in ausführlicher Absprache mit Ihrem Behandlungsteam unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Risikofaktoren, Präferenzen und des allgemeinen Gesundheitszustands getroffen werden.
Quelleninformation
Originaltitel: Primärer Hyperparathyreoidismus
Autoren: Karl L. Insogna, MD
Veröffentlichung: The New England Journal of Medicine, 13. September 2018
DOI: 10.1056/NEJMcp1714213
Dieser patientenfreundliche Artikel basiert auf peer-geprüfter Forschung, die im The New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde. Er bewahrt den vollständigen Inhalt und die wissenschaftliche Genauigkeit der Originalpublikation, während die Informationen für Patienten und ihre Angehörigen zugänglich gemacht werden.