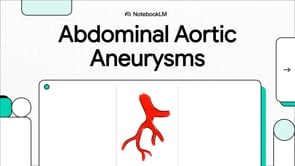Diese Übersichtsarbeit zeigt, dass Uterusmyome 70–80 % der Menschen mit Uterus im Laufe ihres Lebens betreffen, wobei bis zu 50 % Symptome wie starke Blutungen, Anämie und Beckendruck entwickeln. Schwarze Patientinnen leiden häufiger unter schwereren Verläufen und werden im Durchschnitt fünf Jahre später diagnostiziert. Obwohl die Hysterektomie weiterhin häufig durchgeführt wird, gibt es wirksame Alternativen: orale Kombinationen mit GnRH-Antagonisten (Reduktion der Blutungen um 50–75 % und der Schmerzen um 40–50 %), die Uterusarterienembolisation sowie verschiedene Ablationstechniken. Alle diese Verfahren ermöglichen eine deutliche Symptomlinderung bei Erhalt der Gebärmutter.
Uterusmyome verstehen: Symptome, Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten
Inhaltsverzeichnis
- Das klinische Problem: Wie Myome Patientinnen beeinträchtigen
- Diagnose- und Untersuchungsmethoden
- Medikamentöse Behandlungsoptionen
- Chirurgische und interventionelle Alternativen
- Klinische Empfehlungen für Patientinnen
- Studieneinschränkungen
- Quelleninformation
Das klinische Problem: Wie Myome Patientinnen beeinträchtigen
Uterusmyome (auch Leiomyome genannt) sind gutartige Wucherungen in der Gebärmutterwand und der häufigste Grund für Hysterektomien. Diese häufigen Tumoren treten bei bis zu 70–80 % der Menschen mit Uterus im Laufe ihres Lebens auf, wobei nur etwa die Hälfte der Betroffenen tatsächlich Symptome entwickelt.
Die Beschwerden können die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und umfassen:
- Starke und verlängerte Menstruationsblutungen, die an den stärksten Tagen bis zu 8–9 Tampons pro Tag erfordern können
- Eisenmangelanämie mit damit verbundener Müdigkeit
- Druckgefühl im Becken und Blähungen
- Menstruelle und nicht-menstruelle Schmerzen
- Kompressionseffekte auf Darmfunktion (Verstopfung), Blasenfunktion (häufiger Harndrang, Dranginkontinenz oder Harnverhalt) und Sexualfunktion (schmerzhafter Geschlechtsverkehr)
Diagnoseverzögerungen sind ein großes Problem: Ein Drittel der Patientinnen wartet etwa 5 Jahre auf eine Diagnose, manche sogar über 8 Jahre. Diese Verzögerungen beeinträchtigen Fruchtbarkeit, Lebensqualität und finanzielle Stabilität. In einer qualitativen Studie berichteten 95 % der symptomatischen Patientinnen über psychische Auswirkungen wie Depressionen, Sorgen, Wut und Körperbildstörungen.
Die Forschung zeigt erhebliche ethnische Unterschiede. Schwarze Patientinnen entwickeln Myome früher, haben ein höheres kumulatives Symptomrisiko, eine größere Krankheitslast insgesamt und schwerere Verläufe im Vergleich zu weißen Patientinnen. Sie unterziehen sich auch häufiger Hysterektomien und Myomektomien, äußern aber gleichzeitig eine stärkere Präferenz für nicht-invasive Therapien, um Gebärmuttererhalt zu ermöglichen.
Diagnose- und Untersuchungsmethoden
Die Beckensonographie ist die kosteneffektivste bildgebende Erstuntersuchung zur Myomdiagnose. Sie liefert Informationen über Größe, Lage und Anzahl der Myome und schließt andere Tumoren im Becken aus. Ultraschall wird besonders bei abnormalen uterinen Blutungen, tastbaren Beckentumoren und volumenbedingten Symptomen wie Beckendruck oder Blähungen empfohlen.
Allerdings stößt Ultraschall an Grenzen, wenn das Uterusvolumen 375 ml übersteigt oder mehr als vier Myome vorhanden sind. In diesen Fällen bietet die Magnetresonanztomographie (MRT) eine bessere Darstellung und ist besonders nützlich bei Verdacht auf Uterussarkom (ein relativ seltener Krebs, der bei etwa 1 von 770 bis 10.000 Patientinnen mit abnormalen Blutungen auftritt) oder bei der Planung von Hysterektomie-Alternativen.
Die International Federation of Gynecology and Obstetrics entwickelte ein Klassifikationssystem (Typen 0–8), das Klinikerinnen hilft, die Myomlage relativ zur Gebärmutterhöhle und -oberfläche präziser zu beschreiben. Dieses System ermöglicht eine klarere Kommunikation und maßgeschneiderte Behandlungsplanung, wobei niedrigere Zahlen Myome näher am Endometrium anzeigen.
Medikamentöse Behandlungsoptionen
Für Patientinnen, die Alternativen zur Operation suchen, stehen mehrere medikamentöse Optionen zur Verfügung. Kontraceptive Hormone dienen meist als First-Line-Therapie bei myombedingten starken Blutungen, obwohl die Evidenz für ihre Wirksamkeit als gering eingestuft wird.
Weitere Optionen umfassen:
- Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) während der Menstruation
- Tranexamsäure in der Menstruationsphase
- Gonadotropin-Releasing-Hormon(GnRH)-Agonisten in Depotform zur Kurzzeitanwendung
Der bedeutendste Fortschritt in der medikamentösen Therapie sind orale GnRH-Antagonisten-Kombinationen, die Folgendes vereinen:
- Einen oralen GnRH-Antagonisten (Elagolix oder Relugolix), der die ovarielle Steroidproduktion rasch hemmt
- Estradiol und Gestagen in Dosierungen, die systemische Spiegel equivalent zur frühen Follikelphase erzeugen
Klinische Studiendaten zeigen, dass diese Kombinationen starke Menstruationsblutungen um 50–75 % reduzieren, Schmerzen um 40–50 % verringern und volumenbedingte Symptome bei moderater Uterusvolumenreduktion (etwa 10 %) verbessern. Nebenwirkungen bleiben relativ gering, wobei Hitzewallungen, Kopfschmerzen und Übelkeit bei weniger als 20 % der Patientinnen auftreten.
Diese Medikamente sind derzeit in den USA für 24 Monate und in der EU ohne zeitliche Begrenzung zugelassen. Sie bieten jedoch keine Kontrazeption, was eine Einschränkung für die Langzeitanwendung bei vielen Patientinnen darstellt.
Chirurgische und interventionelle Alternativen
Mehrere Verfahren können Blutungen reduzieren, die Myomgröße verringern und die Lebensqualität verbessern, ohne dass eine Hysterektomie nötig ist. Der geeignete Ansatz hängt weitgehend von Myomgröße und -lage ab.
Transzervikale Zugänge (durch den Gebärmutterhals) eignen sich gut für kleinere Myome der Typen 1–4 (submuköse bis intramurale Lagen). Dazu gehören:
- Hysteroskopische Myomektomie: Einsatz eines kleinen Endoskops zur Entfernung von Myomen unter direkter Sicht
- Transzervikale Radiofrequenzablation: Gezielte Energieapplikation unter intrauteriner Sonographiekontrolle zur Erzeugung koagulativer Nekrose
Abdominale Zugänge sind bei größeren Myomen oder denen der Typen 5–7 (subseröse Lagen) erforderlich. Dazu zählen:
- Uterusarterienembolisation: Ein minimal-invasiver Eingriff mittels Katheterisierung, bei dem embolisierende Partikel in die Uterusarterien freigesetzt werden, um ischämische Infarkte der Myome zu verursachen
- MRT-gesteuerte fokussierte Ultraschallablation: Nicht-invasive Prozedur unter Verwendung von Ultraschallenergie, gezielt auf Myome unter MRT-Kontrolle
- Laparoskopische Radiofrequenzablation: Durchführung durch kleine Bauchschnitte unter Ultraschallkontrolle
- Myomektomie: Chirurgische Entfernung von Myomen durch Inzisionen in der Gebärmutterwand
Forschungsergebnisse zeigen, dass die Uterusarterienembolisation eine substantiale Symptomlinderung bietet, obwohl eine randomisierte Studie ergab, dass die Myomektomie hinsichtlich Lebensqualitätsverbesserung überlegen war. Beide Ansätze verbessern Symptome signifikant im Vergleich zu keiner Behandlung.
Klinische Empfehlungen für Patientinnen
Basierend auf der umfassenden Evidenzübersicht sollten Patientinnen mit Uterusmyomen folgendes Vorgehen erwägen:
- Zeitnahe Abklärung suchen bei starken Menstruationsblutungen (mehr als 5–6 Tampons/Binden pro Tag an den stärksten Tagen), Beckendruck oder Menstruationsunfällen
- Beckensonographie anfordern als ersten diagnostischen Schritt, besonders bei abnormalen uterinen Blutungen oder tastbaren Beckentumoren
- Ethnische Disparitäten besprechen mit Ihrer Ärztin – Schwarze Patientinnen sollten ihr erhöhtes Risiko und potenziell schwereren Krankheitsverlauf kennen
- Medikamentöse Optionen zuerst erwägen – Orale GnRH-Antagonisten-Kombinationen bieten significante Symptomreduktion mit akzeptablem Nebenwirkungsprofil
- Uteruserhaltende Verfahren erkunden vor Optieren für eine Hysterektomie, einschließlich Uterusarterienembolisation und verschiedener Ablationstechniken
- Eisenmangelanämie proaktiv angehen, da diese häufige Komplikation die Lebensqualität erheblich beeinträchtigt
Für die im Fallbeispiel beschriebene Patientin – eine 33-jährige Schwarze Frau mit starken Menstruationsblutungen, Eisenmangelanämie und multiplen Myomen, die eine Schwangerschaft in 2 Jahren plant – würde der empfohlene Ansatz zunächst medikamentöses Management mit oralen GnRH-Antagonisten-Kombinationen priorisieren, gefolgt von Reevaluation der Symptome und Fertilitätsziele.
Studieneinschränkungen
Während diese umfassende Übersicht wertvolle Einblicke bietet, sollten mehrere Einschränkungen beachtet werden:
- Kontraceptive Hormone bleiben First-Line-Therapie trotz niedrigqualitativer Evidenz für ihre Wirksamkeit bei myombedingten Blutungen
- Viele klinische Studien schlossen Patientinnen mit großen oder submukösen Myomen aus, was die Generalisierbarkeit der Ergebnisse für diese häufigen Präsentationen limitiert
- Orale GnRH-Antagonisten-Kombinationen bieten keine Kontrazeption, was Limitationen für die Langzeitanwendung schafft
- Selektive Progesteronrezeptormodulatoren sind in den USA aufgrund von Bedenken hinsichtlich seltener aber schwerer hepatischer Toxizität nicht verfügbar
- Mehr Forschung zu Langzeitergebnissen über 24 Monate hinaus ist für neuere medikamentöse Therapien erforderlich
Quelleninformation
Originalartikeltitel: Uterine Fibroids
Autoren: Elizabeth A. Stewart, M.D. und Shannon K. Laughlin-Tommaso, M.D., M.P.H.
Publikation: The New England Journal of Medicine, 7. November 2024
DOI: 10.1056/NEJMcp2309623
Dieser patientenfreundliche Artikel basiert auf peer-reviewter Forschung, ursprünglich veröffentlicht in The New England Journal of Medicine. Er bewahrt alle signifikanten Befunde, Datenpunkte und klinischen Empfehlungen der Originalarbeit, während die Information für gebildete Patientinnen zugänglich gemacht wird.