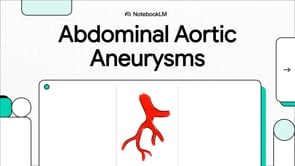Diese Übersichtsarbeit zeigt, dass Vestibularisschwannome – gutartige Tumoren des Innenohrs – häufiger vorkommen als früher angenommen; etwa einer von 500 Menschen ist im Laufe des Lebens betroffen. Moderne MRT-Untersuchungen erlauben eine frühere Diagnose auch kleiner Tumore bei älteren Patienten, wobei in vielen Fällen zunächst eine abwartende Strategie verfolgt wird. Die Behandlungsmöglichkeiten reichen von regelmäßiger Überwachung über Strahlentherapie bis hin zu chirurgischen Eingriffen. Die optimale Vorgehensweise hängt von der Tumorgröße, dem Alter des Patienten und den vorliegenden Symptomen ab.
Vestibularisschwannome verstehen: Ein umfassender Patientenratgeber
Inhaltsverzeichnis
- Einführung: Was sind Vestibularisschwannome?
- Aktuelle Erkenntnisse zur Häufigkeit
- Krankheitsbild und Symptome
- Diagnostik und Untersuchungen
- Behandlungsmöglichkeiten
- Wait-and-Scan (Aktive Überwachung)
- Radiochirurgie
- Quellen
Einführung: Was sind Vestibularisschwannome?
Vestibularisschwannome (früher auch Akustikusneurinome genannt) sind gutartige Tumoren, die etwa 8 % aller Hirntumoren ausmachen. Sie sind die häufigsten Tumoren im Kleinhirnbrückenwinkel bei Erwachsenen.
Diese Tumoren entstehen aus den Schwann-Zellen, die den Gleichgewichtsnerv (Nervus vestibularis) umhüllen. Dieser ist Teil des achten Hirnnervs und für Gleichgewicht und Hören zuständig. Obwohl oft als selten eingestuft, zeigen neuere Studien, dass etwa einer von 500 Menschen im Laufe des Lebens betroffen ist.
Die Behandlung ist aufgrund des unvorhersehbaren Tumorverhaltens und der Bedeutung der Lebensqualität umstritten. Die Ansätze variieren erheblich zwischen verschiedenen Kliniken und Ländern.
Mehrere Entwicklungen haben Diagnose und Therapie verändert: Der breite Zugang zu empfindlichen MRT-Untersuchungen hat die Entdeckungsrate erhöht, wobei viele Tumoren zufällig bei älteren Patienten gefunden werden. Zunehmend setzt sich eine konservative Behandlung durch, die den Erhalt neurologischer Funktionen priorisiert.
Aktuelle Erkenntnisse zur Häufigkeit
Die höhere Entdeckungsrate liegt primär an verbesserter Diagnostik, nicht an einer tatsächlichen Zunahme der Tumoren. Von den 1900er Jahren bis in die 1970er Jahre blieb die Inzidenz stabil bei etwa 1 Fall pro 100.000 Menschen pro Jahr.
Aktuell liegt die Rate bei 3 bis 5 Fällen pro 100.000 Personenjahre, mit steigender Tendenz im letzten Jahrzehnt. Besonders deutlich ist der Anstieg bei über 70-Jährigen, wo mittlerweile 20 Fälle pro 100.000 Personenjahre erreicht werden.
Heute werden viele Patienten in ihren 60ern oder 70ern mit nur millimetergroßen Tumoren diagnostiziert. Daten aus Dänemark über vier Jahrzehnte zeigen: Das Durchschnittsalter bei Diagnose stieg von 49 auf 60 Jahre, die mittlere Tumorgröße sank von 2,8 cm auf 0,7 cm.
In Regionen mit guter MRT-Versorgung werden bis zu 25 % der Fälle zufällig entdeckt, etwa bei Untersuchungen wegen Kopfschmerzen. Umweltfaktoren wie Handynutzung oder Lärmexposition wurden als Risikofaktoren diskutiert, große Studien konnten dies jedoch nicht bestätigen.
Krankheitsbild und Symptome
Häufige Symptome sind:
- Einseitiger Hörverlust (bei über 90 % der Patienten)
- Schwindel oder Gleichgewichtsstörungen (bis zu 61 %)
- Einseitiger Tinnitus (55 %)
Der Hörverlust beginnt oft schleichend und fällt vielleicht erst beim Telefonieren oder im Liegen auf. Viele Betroffene haben zunehmend Probleme mit dem Richtungshören und dem Sprachverständnis in lauter Umgebung.
Interessanterweise treten trotz des Ursprungs am Gleichgewichtsnerv Schwindelattacken (Vertigo) nur in etwa 8 % der Fälle auf, anhaltender Schwindel in 3 %. Dies liegt vermutlich am langsamen Funktionsverlust, der dem Gehirn Zeit zur Kompensation lässt.
Bei großen Tumoren, die auf Hirnstamm oder Kleinhirn drücken, können Taubheitsgefühle im Gesicht, Gesichtsschmerzen (Trigeminusneuralgie), Koordinationsstörungen oder ein Hydrozephalus auftreten. Wichtig: Die Tumorgröße korreliert nur begrenzt mit der Schwere von Hörverlust, Tinnitus oder Schwindel.
Diagnostik und Untersuchungen
Die dünnschichtige, kontrastmittelgestützte MRT des Kopfes ist der Goldstandard zur Diagnose und erkennt Tumoren ab 2 mm Durchmesser. Die Methode ist hochsensitiv und spezifisch, sodass meist keine Biopsie nötig ist.
Ein Screening-MRT wird vor allem bei plötzlichem oder einseitigem Hörverlust empfohlen, der im Hörtest auffällt. In diesem Fall liegt die Wahrscheinlichkeit für ein Vestibularisschwannom bei 1–5 %.
Gängige Protokolle sehen eine MRT vor, wenn ein Hörunterschied von ≥10 dB in zwei Frequenzen oder ≥15 dB in einer Frequenz besteht. Bei einseitigem Tinnitus oder Gleichgewichtsstörungen sind die Leitlinien weniger klar.
Patienten mit einem isolierten, einseitigen Tumor ohne Hinweise auf Neurofibromatose Typ 2 oder familiäre Vorbelastung benötigen in der Regel keine genetische Testing.
Behandlungsmöglichkeiten
Therapieoptionen umfassen:
- Aktive Überwachung (Wait-and-Scan)
- Strahlentherapie (Radiochirurgie)
- Mikrochirurgische Entfernung
- Kombinationen dieser Verfahren
Verschiedene Medikamente wie Aspirin oder monoklonale Antikörper wurden untersucht, um das Wachstum zu stoppen, bleiben aber experimentell. Bisher gibt es keine Belege dafür, dass eine Behandlungsmethode den anderen klar überlegen ist.
Jede Strategie hat Vor- und Nachteile. Studien zeigen, dass die Diagnose selbst und patientenindividuelle Faktoren die Lebensqualität stärker beeinflussen als die Therapiewahl. Die Tumorgröße ist zwar entscheidend, aber auch subtile Faktoren seitens des Patienten und des Behandlungsteams fließen in die Entscheidung ein.
Wait-and-Scan (Aktive Überwachung)
Dieser Ansatz gewinnt an Bedeutung, da viele Tumoren bei älteren Patienten mit milden Symptomen entdeckt werden. Studien der letzten 15 Jahre zeigen, dass nur 22–48 % der Tumoren wachsen (definiert als Zunahme um ≥2 mm) über durchschnittlich 2,6–7,3 Jahre.
Für eine Überwachung kommen typischerweise Tumoren unter 1,5 cm im Kleinhirnbrückenwinkel infrage. Der beste Prädiktor für Wachstum ist eine größere Ausgangsgröße.
Bildgebung und Hörtests erfolgen meist 6 Monate nach der Erstdiagnose, um schnell wachsende Tumoren zu erkennen. Bei Stabilität danach: jährlich bis zum 5. Jahr, dann alle zwei Jahre. Wegen der Unvorhersehbarkeit des Wachstums wird eine lebenslange Nachsorge empfohlen.
Ein fortschreitender Hörverlust ist unter Überwachung zu erwarten. Von 636 Patienten mit gutem Hörvermögen bei Diagnose (Sprachverständnis >70 %) behielten nach 10 Jahren nur 31 % diese Hörschwelle. Allerdings hatten 88 % der Patienten mit anfangs perfektem Sprachverständnis (100 %) nach 10 Jahren noch gutes Hörvermögen (>70 %).
Radiochirurgie
Die stereotaktische Radiochirurgie appliziert hochpräzise Strahlung in 1–5 Sitzungen und schont umliegendes Gewebe. Eine gängige Methode ist die Gamma-Knife-Radiochirurgie mit 192 Kobalt-60-Quellen.
Die Behandlung erfordert einen stereotaktischen Rahmen und spezielle Bildgebung zur 3D-Zielung. Im Gegensatz zur Operation bleibt der Tumor erhalten, hört aber meist auf zu wachsen und kann über Jahre schrumpfen.
Kandidaten sind typically Patienten mit Tumoren unter 3,0 cm, idealerweise unter 2,5 cm zur Risikominimierung. Die Einzelfraktionstherapie mit einer Randdosis von ≤13 Gy birgt ein <1 %-Risiko für dauerhafte Gesichtsnervschwäche und <5 % für Trigeminusprobleme.
Aktuelle Serien berichten über eine Tumorkontrolle von >90 % nach 10 Jahren. Das Risiko für ein Sekundärkarzinom liegt bei etwa 0,02 %.
Quellen
Originaltitel: Vestibular Schwannomas
Autoren: Matthew L. Carlson, M.D., und Michael J. Link, M.D.
Publikation: The New England Journal of Medicine, 8. April 2021
DOI: 10.1056/NEJMra2020394
Dieser patientenfreundliche Artikel basiert auf einer peer-reviewten Publikation im NEJM. Die Informationen wurden verständlich aufbereitet, alle wissenschaftlichen Daten und Empfehlungen entsprechen der Originalstudie.