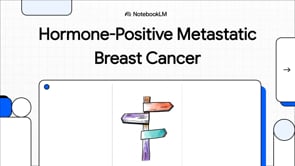Diese Übersichtsarbeit erläutert, wie einfache Bluttests – sogenannte Flüssigbiopsien – vorhersagen könnten, welche Brustkrebspatientinnen von CDK4/6-Inhibitoren profitieren und frühzeitig Hinweise auf Therapieresistenzen erkennen lassen. Während genetische Blutuntersuchungen bisher nur begrenzt klare Biomarker identifizieren konnten, zeigen neuartige epigenetische Ansätze, die die Regulation von Genen analysieren, großes Potenzial für eine personalisierte Behandlung und verbesserte Therapieergebnisse bei Patientinnen mit fortgeschrittenem, hormonrezeptorpositivem Brustkrebs.
Bluttests zur Vorhersage des Therapieansprechens und der Resistenz bei Brustkrebs
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Die Herausforderung der Therapieresistenz
- Präzisionsonkologie und Brustkrebsbehandlung
- Wie CDK4/6-Inhibitoren wirken und warum Resistenzen entstehen
- Liquid Biopsy: Eine minimalinvasive Alternative zu Gewebebiopsien
- Genetische Biomarker im Blut zur Vorhersage des Therapieansprechens
- Die Zukunft: Epigenetische Biomarker in Liquid Biopsies
- Zusammenfassung und klinische Implikationen
- Quelleninformationen
Einleitung: Die Herausforderung der Therapieresistenz
Brustkrebs ist weltweit die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Rund 70 % der Fälle sind östrogenrezeptorpositiv (ER+) und humaner epidermaler Wachstumsfaktorrezeptor 2-negativ (HER2-). Zwar helfen Screening-Programme, viele Tumore in frühen, besser behandelbaren Stadien zu erkennen, doch besteht lebenslang das Risiko von Metastasen. Sobald Brustkrebs in entfernte Organe streut, gilt er trotz verfügbarer Therapien in der Regel als unheilbar.
In den letzten zehn Jahren haben CDK4/6-Inhibitoren in Kombination mit endokriner Therapie die Behandlung von ER+/HER2- metastasiertem Brustkrebs revolutioniert. Drei Wirkstoffe dieser Klasse – Abemaciclib, Palbociclib und Ribociclib – zeigten in großen klinischen Studien signifikante Vorteile: Sie verbesserten Ansprechraten, progressionsfreies Überleben, Lebensqualität und Gesamtüberleben von Patientinnen mit fortgeschrittener Erkrankung.
Dennoch bleibt die Therapieresistenz eine große Herausforderung. Eine Minderheit der Patientinnen spricht von vornherein nicht auf die Behandlung an; bei ihnen schreitet die Krankheit innerhalb von sechs Monaten fort. Selbst bei anfänglichem Ansprechen entwickeln Patientinnen im Laufe der Zeit fast immer eine erworbene Resistenz. Das mediane progressionsfreie Überleben liegt in der Erstlinientherapie des metastasierten Brustkrebses zwischen 23,8 und 28,2 Monaten.
Dieses dringende klinische Problem unterstreicht den Bedarf an Biomarkern, die vorhersagen können, welche Patientinnen von CDK4/6-Inhibitoren profitieren, und die Resistenzen früh erkennen lassen. Während gewebebasierte Biomarker intensiv erforscht werden, ist der einzige klinisch verfügbare Prädiktor bislang der Brustkrebssubtyp (ER+/HER2-). Tumorheterogenität und die Schwierigkeit, endokrine Resistenz von CDK4/6-Inhibitor-Resistenz zu unterscheiden, erschweren die Biomarker-Entwicklung.
Präzisionsonkologie und Brustkrebsbehandlung
Die Präzisionsonkologie nutzt molekulare Informationen aus dem Tumor, um Behandlungen zu optimieren und zu individualisieren. Diese Strategie hilft Ärzten, wirksame Therapien auszuwählen und gleichzeitig Nebenwirkungen zu minimieren. Molekulare Biomarker lassen sich in zwei Kategorien einteilen: prognostische Biomarker, die den Krankheitsverlauf unabhängig von der Behandlung vorhersagen, und prädiktive Biomarker, die das Ansprechen auf bestimmte Therapien anzeigen.
Aktuelle Brustkrebsbehandlungen liefern gute Beispiele für biomarker-gesteuerte Präzisionsonkologie:
- OncotypeDx: Ein kommerzieller 21-Gen-Test für ER+ Brustkrebs im Frühstadium, der die Rückfallwahrscheinlichkeit ohne Chemotherapie berechnet
- MammaPrint: Ein Microarray-Assay mit 70 Genen zur Risikoklassifizierung von Rezidiven
- HER2-Status: Bestimmt, ob Patientinnen von HER2-zielgerichteten Medikamenten wie Trastuzumab profitieren
- Hormonrezeptorstatus: Identifiziert Tumore, die auf endokrine Therapie ansprechen
Resistenz gegen endokrine Therapie kann durch verschiedene Mechanismen entstehen, darunter genetische Veränderungen von ESR1, erhöhte Aktivität von Cyclin-abhängigen Kinasen (CDKs), Aktivierung von Signalwegen wie PI3K und RAS oder verminderte Spiegel von CDK-Hemmern wie p16, p21 und p27. Viele dieser Resistenzwege konvergieren auf der Cyclin D-CDK4/6-Achse, was erklärt, warum die Kombination von endokriner Therapie mit CDK4/6-Inhibitoren bei ER+/HER2- metastasiertem Brustkrebs so erfolgreich ist.
Wie CDK4/6-Inhibitoren wirken und warum Resistenzen entstehen
Der Cyclin D-CDK4/6-Retinoblastom-Protein (Rb)-Weg reguliert den Übergang von der G1- zur S-Phase des Zellzyklus. Normalerweise bleibt Rb unphosphoryliert und bindet E2F-Transkriptionsfaktoren, wodurch diese inaktiv bleiben. Bei Wachstumssignalen treten Zellen in die G1-Phase ein, was zur Cyclin D-Expression führt. Cyclin D bindet an CDK4/6 und bildet einen aktiven Komplex, der Rb phosphoryliert.
Diese Phosphorylierung bewirkt, dass Rb seine Form ändert und E2F-Transkriptionsfaktoren freisetzt, die den Eintritt in die S-Phase und den weiteren Zellzyklus antreiben. Der Cyclin D-CDK4/6-Komplex aktiviert auch den FOXM1-Transkriptionsfaktor, was den Fortschritt durch spätere Zellzyklusphasen (G2/M) fördert. ER+ Brustkrebs ist stark von diesem Weg abhängig, da Östrogen die Cyclin D1-Expression antreibt und über die CDK4/6-Signalgebung die Zellteilung fördert.
CDK4/6-Inhibitoren binden an die ATP-Domäne von CDK4/6, halten den Übergang von G1 zu S-Phase an und verhindern so die Krebszellteilung. Allerdings sind Resistenzmechanismen noch nicht vollständig verstanden, und die klinische Relevanz vieler laboridentifizierter Mechanismen bleibt unbestätigt.
Bekannte Resistenzmechanismen umfassen:
- Amplifikation von Mitgliedern des Cyclin D-CDK4/6-Signalwegs
- Herunterregulierung von CDK4/6-Repressorproteinen wie p21 und p27
- Veränderungen in RB1, FAT1 oder Signalwegen wie PI3K/AKT/mTOR und KRAS, die den G1/S-Checkpoint umgehen
Diese Veränderungen ermöglichen es Krebszellen, sich trotz CDK4/6-Inhibitor-Behandlung weiter zu teilen, was letztlich zum Therapieversagen führt.
Liquid Biopsy: Eine minimalinvasive Alternative zu Gewebebiopsien
Liquid Biopsy-Ansätze sind vielversprechende Alternativen zu traditionellen Gewebebiopsien für die Gewinnung molekularer Krebsinformationen. Während Gewebebiopsien invasive Eingriffe erfordern, die nicht immer möglich sind, umgehen Liquid Biopsies diese Einschränkungen, indem sie tumorabgeleitetes Material in leicht zugänglichen Körperflüssigkeiten nachweisen.
Für die meisten Anwendungen dient peripheres Blutplasma als bevorzugte Flüssigkeit. Früher stellte die Blut-Hirn-Schranke eine Hürde für den Nachweis von Hirntumoren dar, doch neuere Technologien haben die Nachweisempfindlichkeit verbessert. Andere Flüssigkeiten können für bestimmte Krebsarten informativer sein, etwa Speichel für Mundhöhlenkrebs, Urin für Blasenkrebs und Liquor cerebrospinalis für Hirntumore.
Liquid Biopsies können verschiedene Tumorkomponenten analysieren, darunter:
- Zirkulierende Tumorzellen (CTCs) – intakte Krebszellen im Blut
- Zellfreie DNA (cfDNA) – DNA-Fragmente im Blut
- Extrazelluläre Vesikel – kleine von Zellen freigesetzte Partikel
- Zellfreie RNA – RNA-Moleküle in der Zirkulation
Dieser Überblick konzentriert sich auf zirkulierende tumorDNA (ctDNA), die tumorabgeleitete genetische und epigenetische Informationen enthält, die beim Absterben von Krebszellen ins Blut gelangen. ctDNA macht typischerweise einen kleinen Anteil (manchmal <0,01 %) der gesamten zellfreien DNA aus; der Großteil stammt von Blutzellen und anderen Geweben.
ctDNA-Spiegel variieren je nach Tumorgröße, Stadium, Lokalisation, Behandlungsstatus und der Fähigkeit des Tumors, DNA freizusetzen. Einmal im Blut, wird ctDNA schnell mit einer Halbwertszeit zwischen 16 Minuten und 2 Stunden abgebaut – durch Enzymabbau, Immunzellaufnahme und Nierenfiltration. Dieser schnelle Umsatz ermöglicht es ctDNA, eine "Echtzeit"-Momentaufnahme des Krankheitsstatus zu liefern.
Die Analyse von ctDNA durch Liquid Biopsy könnte in mehreren Phasen der CDK4/6-Inhibitor-Behandlung wertvoll sein:
- Prognostik – Vorhersage von Krankheitsverläufen
- Behandlungsindividualisierung – Entscheidung über CDK4/6-Inhibitoren oder zusätzliche Medikamente
- Therapiemonitoring – Verfolgung des Therapieansprechens
- Resistenzdetektion – Früherkennung sich entwickelnder Resistenzen
Kliniker können ctDNA mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) für einzelne Gene oder Next-Generation Sequencing (NGS) für Dutzende bis Hunderte von Genen analysieren. Für ER+/HER2- fortgeschrittenen Brustkrebs detektiert der therascreen PIK3CA RGQ PCR-Kit bereits PIK3CA-Mutationen, um die Behandlung mit PI3Kα-Inhibitoren wie Alpelisib zu steuern. NGS-basierte Assays umfassen typischerweise PIK3CA zusammen mit anderen für endokrine Therapieresistenz relevanten Genen wie ESR1 und PTEN.
Genetische Biomarker im Blut zur Vorhersage des Therapieansprechens
Derzeit gibt es keine klinisch validierten Liquid Biopsy-Biomarker, die vorhersagen können, welche Patientinnen am meisten von CDK4/6-Inhibitoren profitieren. Die Forschung konzentriert sich vor allem auf genetische Alterationen in Zellzyklusgenen, die durch ctDNA-Analyse detektiert werden, und ihre Beziehung zu Behandlungsergebnissen.
RB1-Alterationen: Da Rb das zentrale Ziel von CDK4/6 bei der Zellzykluskontrolle ist, können genetische Veränderungen von RB1, die zu seiner Inaktivierung führen, Resistenz verleihen. In der PALOMA-3-Studie war der Verlust von RB1 in der Ausgangs-ctDNA mit einem schlechteren progressionsfreien Überleben unter Palbociclib plus Fulvestrant assoziiert. Analysen aus den MONALEESA-Studien ergaben, dass Patientinnen mit RB1-Mutationen unter Ribociclib plus endokriner Therapie keine signifikante Verbesserung des medianen progressionsfreien Überlebens erfuhren. Weitere Studien identifizierten loss-of-function RB1-Mutationen, die während der CDK4/6-Inhibitor-Behandlung erworben wurden, was auf Selektion als Resistenzmechanismus hindeutet. Die niedrige Prävalenz (4,7 % in einer Studie) legt nahe, dass andere Mechanismen eine wichtige Rolle spielen.
ESR1-Mutationen: Die Forschung zeigt gemischte Ergebnisse zu ESR1-Mutationen als Biomarker für das CDK4/6-Inhibitor-Ansprechen. In PALOMA-3 hatten Patientinnen unter Palbociclib unabhängig vom ESR1-Status ein ähnlich verbessertes medianes progressionsfreies Überleben (9,4 vs. 9,5 Monate für mutiert vs. Wildtyp). Interessanterweise erwarben einige Patientinnen in beiden Armen während der Behandlung ESR1 Y537S-Mutationen, die mit einem verbesserten medianen progressionsfreien Überleben assoziiert waren (13,7 vs. 7,4 Monate). In MONARCH-2 zeigten Patientinnen unter Abemaciclib unabhängig vom ESR1-Status ein verbessertes progressionsfreies Überleben, wobei mutierte Tumore einen höheren numerischen Wert aufwiesen (20,7 vs. 15,3 Monate).
PIK3CA-Mutationen: Studien zeigen konsistent, dass der PIK3CA-Status keinen differenziellen Nutzen von CDK4/6-Inhibitoren vorhersagt. In PALOMA-3 hatten Patientinnen unter Palbociclib unabhängig vom PIK3CA-Status ein ähnlich verbessertes progressionsfreies Überleben (9,5 vs. 9,9 Monate für mutiert vs. Wildtyp). MONARCH-2 fand ähnliche Ergebnisse, obwohl Patientinnen in der Placebogruppe mit PIK3CA-Mutationen ein schlechteres medianes progressionsfreies Überleben hatten (5,7 vs. 12,3 Monate). Kleinere Studien deuteten auf schlechtere Outcomes hin, was größere Studien jedoch nicht bestätigten.
FGFR-Alterationen: Begrenzte Evidenz deutet darauf hin, dass FGFR-Alterationen das Ansprechen auf CDK4/6-Inhibitoren beeinflussen könnten. In MONALEESA-2 zeigten Patientinnen mit FGFR1-Alterationen unter Ribociclib ein schlechteres medianes progressionsfreies Überleben (10,61 vs. 24,84 Monate), allerdings ohne statistische Signifikanz aufgrund der kleinen Stichprobe. PALOMA-3 ergab, dass Patientinnen mit FGFR1-Amplifikationen in beiden Armen ein schlechteres progressionsfreies Überleben aufwiesen, während erworbene FGFR2-Alterationen keinen erkennbaren Unterschied zeigten.
Die Zukunft: Epigenetische Biomarker in Liquid Biopsies
Während genetisch basierte Ansätze nur begrenzte Fortschritte bei der Identifizierung prädiktiver Biomarker für CDK4/6-Inhibitoren erzielt haben, zeigen sich vielversprechende epigenetische Methoden. Epigenetik bezieht sich auf Modifikationen, die die Genexpression regulieren, ohne die DNA-Sequenz zu verändern, darunter DNA-Methylierung, Histonmodifikationen und Chromatin-Umbau.
Die epigenetische Profilierung von ctDNA könnte neue Biomarker aufdecken, die Wirksamkeit und Resistenzmechanismen besser vorhersagen. Im Gegensatz zu stabilen genetischen Alterationen können epigenetische Veränderungen dynamisch auf Behandlungsdruck und Umweltfaktoren reagieren und potenziell sensitivere Indikatoren für entstehende Resistenzen liefern.
Die Forschung in diesem Bereich entwickelt sich noch, aber frühe Studien deuten darauf hin, dass epigenetische Marker in ctDNA folgendes könnten:
- Resistenzen früher als genetische Veränderungen erkennen
- Einblicke in mehrere Resistenzmechanismen gleichzeitig bieten
- Informationen über Tumorheterogenität und -evolution unter Behandlungsdruck liefern
- Patientinnen identifizieren, die von epigenetisch zielgerichteten Kombinationstherapien profitieren könnten
Da epigenetische Technologien weiter voranschreiten und zugänglicher werden, werden sie voraussichtlich eine zunehmend wichtige Rolle bei der Personalisierung der CDK4/6-Inhibitor-Behandlung und dem Resistenzmanagement spielen.
Zusammenfassung und klinische Implikationen
Dieser Überblick hebt den aktuellen Stand und das Potenzial von Liquid Biopsies zur Vorhersage der Wirksamkeit und Resistenz von CDK4/6-Inhibitoren bei Brustkrebs hervor. Während genetische Ansätze noch keine klinisch validierten prädiktiven Biomarker erbracht haben, entwickelt sich das Feld rasant mit vielversprechenden epigenetischen Methoden.
Für Patientinnen bedeutet diese Forschung, dass einfache Blutuntersuchungen Onkologen bald dabei helfen könnten:
- Vor Behandlungsbeginn vorherzusagen, wer am meisten von CDK4/6-Inhibitoren profitieren wird
- Das Ansprechen auf die Behandlung durch regelmäßige Blutuntersuchungen statt Scans zu überwachen
- Entstehende Resistenzen früher zu erkennen, um rechtzeitig Behandlungen anzupassen
- Kombinationstherapien basierend auf individuellen Resistenzmechanismen zu personalisieren
Die untersuchten Studien zeigen, dass zwar spezifische genetische Alterationen (insbesondere in RB1) Potenzial als Resistenzbiomarker haben, ihre geringe Prävalenz jedoch darauf hindeutet, dass mehrere Mechanismen zum Therapieversagen beitragen. Diese Komplexität unterstreicht die Notwendigkeit umfassender Ansätze, die das gesamte Spektrum der Resistenzwege erfassen.
Da Liquid Biopsy-Technologien in Sensitivität, Kosteneffektivität und klinischer Zugänglichkeit weiter verbessert werden, werden sie voraussichtlich integrale Bestandteile des Brustkrebsmanagements. Die Möglichkeit, die Tumorbiologie durch einfache Blutentnahmen wiederholt zu beurteilen, ist ein bedeutender Fortschritt gegenüber traditionellen Gewebebiopsien, besonders für die Überwachung des Therapieansprechens und die Echtzeit-Erkennung von Resistenzen.
Patientinnen sollten mit ihren Onkologen besprechen, ob die Teilnahme an klinischen Studien mit Liquid Biopsy-Analyse für sie geeignet sein könnte, da dieses schnell entwickelnde Feld weiterhin neue Erkenntnisse generiert, die Behandlungsentscheidungen und -ergebnisse direkt beeinflussen können.
Quelleninformationen
Originalartikeltitel: Liquid biopsies to predict CDK4/6 inhibitor efficacy and resistance in breast cancer
Autoren: Sasha C. Main, David W. Cescon, Scott V. Bratman
Veröffentlichung: Cancer Drug Resist 2022;5:727-48
DOI: 10.20517/cdr.2022.37
Dieser patientenfreundliche Artikel basiert auf peer-reviewter Forschung und zielt darauf ab, komplexe wissenschaftliche Informationen für gebildete Patientinnen und ihre Familien zugänglich zu machen. Er bewahrt alle wichtigen Erkenntnisse, Datenpunkte und klinischen Implikationen der Originalforschung, während technische Sprache in verständlichere Begriffe übersetzt wird.