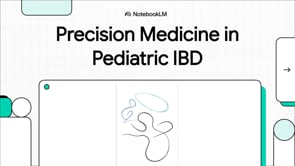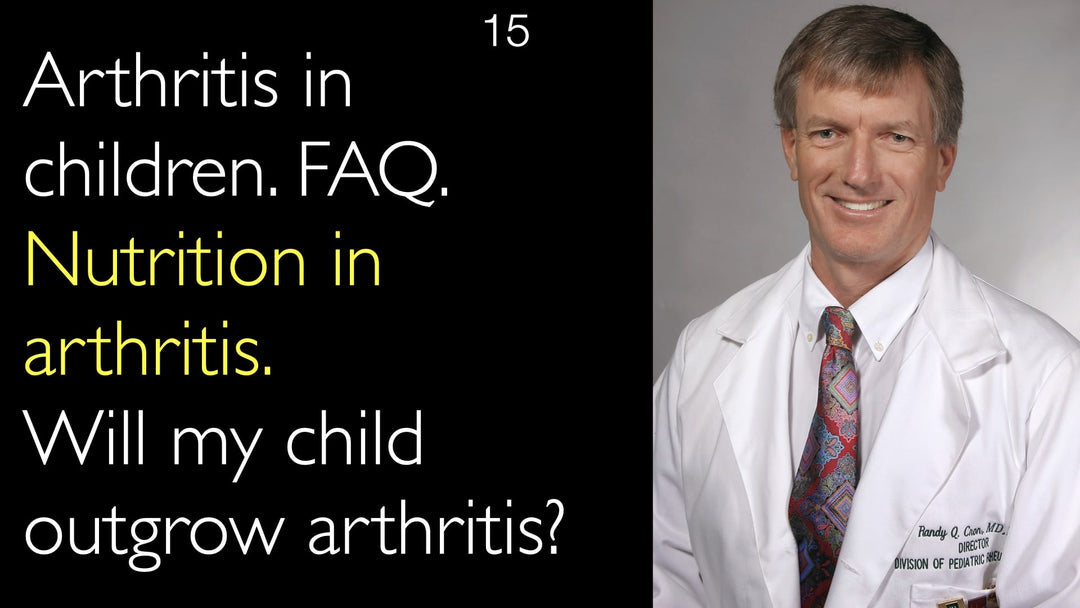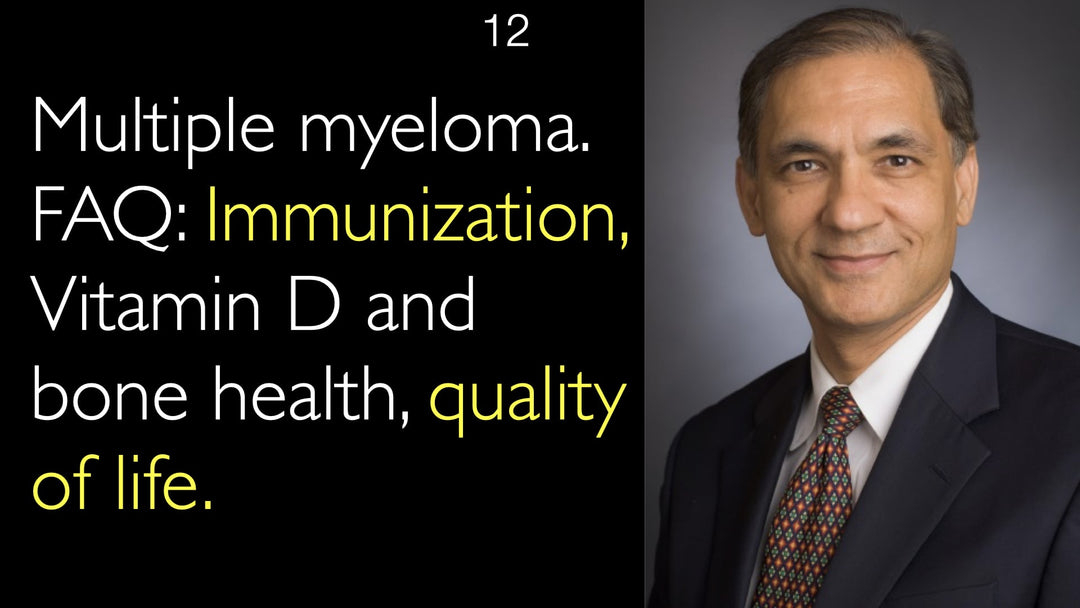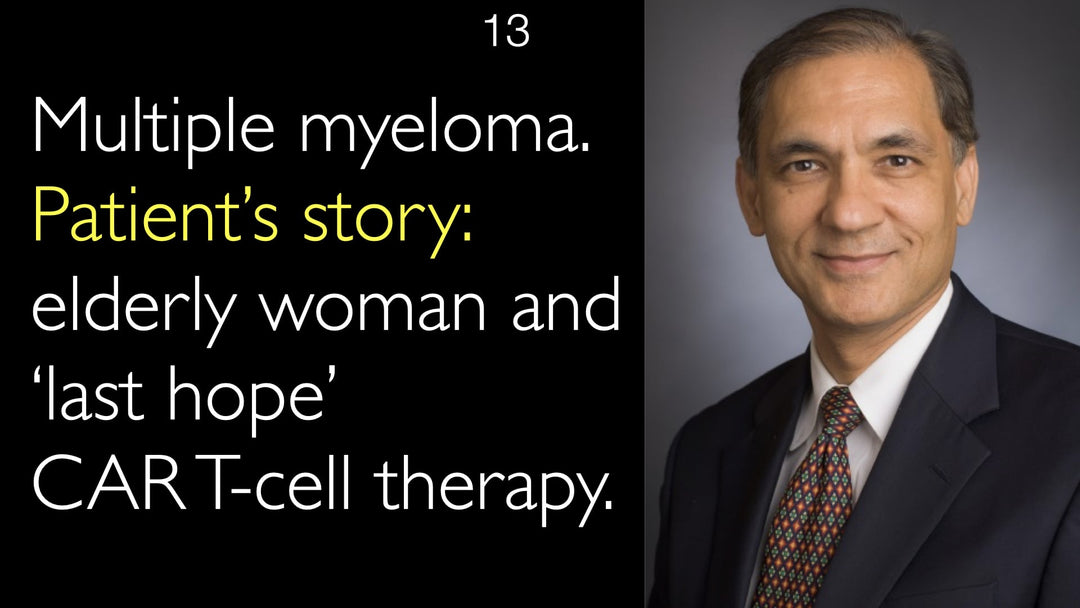Diese Übersichtsarbeit beleuchtet, wann und wie die optimale Behandlung für Kinder mit chronisch-entzündlicher Darmerkrankung (CED) ausgewählt werden sollte. Studien belegen, dass ein frühzeitiger Einsatz wirksamer Biologika bei Morbus Crohn deutlich bessere Ergebnisse erzielt – einige Untersuchungen zeigen Remissionsraten von 85 % im Vergleich zu 60 % unter konventioneller Therapie – während die Vorteile bei Colitis ulcerosa weniger eindeutig sind. Der Artikel erörtert zudem, wie Ärzte vorhersagen können, welche Patienten eine aggressivere Behandlung benötigen, und wie die Reihenfolge der Medikamentengabe deren Wirksamkeit im Krankheitsverlauf beeinflusst.
Die richtige Therapie zum richtigen Zeitpunkt bei Kindern mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Die therapeutische Herausforderung bei pädiatrischen CED
- Der richtige Zeitpunkt: Frühzeitige effektive Therapie
- Behandlung einer progredienten Erkrankung
- Das Problem der Step-up-Therapie
- Vorteile einer frühen Therapie bei Morbus Crohn
- Vorteile einer frühen Therapie bei Colitis ulcerosa
- Diskussion zur Definition von „früh“
- Der richtige Patient: Vorhersage des Krankheitsverlaufs
- Klinische Einflussfaktoren auf die Prognose
- Klinisch verfügbare Proteinmarker
- Zukünftige prädiktive Biomarker
- Das richtige Medikament: Sequenzierung und Therapieentscheidungen
- Wahl der Erstlinientherapie
- Spielt die Behandlungsreihenfolge eine Rolle?
- Kombinationstherapie-Ansätze
- Zusammenfassung und Empfehlungen
- Quelleninformation
Einleitung: Die therapeutische Herausforderung bei pädiatrischen CED
Trotz mehr Behandlungsoptionen als je zuvor besteht bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) nach wie vor eine erhebliche Therapielücke. In klinischen Studien sprechen in der Regel nicht mehr als 30 % der Patienten auf die Therapie an. Viele Patienten finden erst nach dem Versagen mehrerer Medikamente die richtige Behandlung, was zu Einschränkungen, psychischem Stress und dauerhaften Schäden der Darmwand führen kann.
Die Lösung dieses Problems liegt in der Präzisionsmedizin – der Auswahl des richtigen Patienten, der richtigen Therapie, des richtigen Zeitpunkts, der richtigen Dosis und der richtigen Überwachungsstrategie. Dieser Artikel konzentriert sich auf den kritischen Prozess, den richtigen Patienten zur richtigen Zeit der richtigen Therapie zuzuordnen, mit besonderem Fokus auf pädiatrische CED, bei denen im Vergleich zu Erwachsenenstudien häufig spezifische Daten fehlen.
Der richtige Zeitpunkt: Frühzeitige effektive Therapie
Der Zeitpunkt des Therapiebeginns ist entscheidend für die effektive Behandlung von CED. Der Ansatz hat sich von der traditionellen „Step-up“-Therapie (Beginn mit weniger wirksamen Medikamenten) zur „frühzeitigen effektiven“ Therapie (Einsatz wirksamerer Behandlungen von Anfang an bei geeigneten Patienten) gewandelt.
Behandlung einer progredienten Erkrankung
CED, zu denen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa gehören, sind fortschreitende chronische Erkrankungen, die irreversible Darmschäden verursachen. Aktuelle Behandlungen zielen auf die Reduzierung von Entzündungen ab, können aber bestehende Schäden an der Darmwand nicht rückgängig machen. Dieser natürliche Verlauf führt oft zu Komplikationen, die chirurgische Eingriffe erforderlich machen.
Bei Morbus Crohn ist Fibrose (Narbengewebsbildung) eine bekannte Komplikation, die bei einem Drittel der Patienten zu Strikturen (Verengungen) führt. Pädiatrischer Morbus Crohn weist typischerweise einen schwereren Phänotyp auf als die Erwachsenenform, was darauf hindeutet, dass Kinder aufgrund ihrer längeren Krankheitsdauer noch mehr von einer frühzeitigen aggressiven Therapie profitieren könnten, um Schäden durch chronische Entzündungen zu verhindern.
Colitis ulcerosa wurde erst kürzlich als progredient erkannt. Über die Hälfte der CU-Patienten erlebt eine Krankheitsausdehnung, und ein kleiner Anteil entwickelt kolonische fibrotische Strikturen. Krankheitsdauer, -schwere und -aktivität sind alle mit einem erhöhten Risiko für kolorektalen Karzinom assoziiert.
Das Problem der Step-up-Therapie
Historisch wurde CED mit „Step-up“-Therapie behandelt, was das Versagen weniger wirksamer Medikamente wie Mesalazin und Thiopurine vor dem Beginn von Biologika erforderte, selbst bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Erkrankung. Es gibt nun Hinweise darauf, dass dieser Ansatz dazu führt, dass Patienten ein wichtiges „Zeitfenster der Gelegenheit“ verpassen, um ihren Krankheitsverlauf durch schnelle Kontrolle der Entzündung dauerhaft zu verändern.
Trotz dieses Verständnisses bleibt die Step-up-Therapie weit verbreitet. Eine große US-Versicherungsdatenbankstudie (28.119 CU-Patienten und 16.260 MC-Patienten) aus den Jahren 2008–2016 ergab, dass weniger als 1 % der CU-Patienten und weniger als 5 % der MC-Patienten Erstlinien-Biologika erhielten. Stattdessen begannen 61 % der CU-Patienten mit 5-Aminosalicylsäure-Monotherapie und 42 % der MC-Patienten mit Kortikosteroid-Monotherapie.
Versicherungsgesellschaften schreiben häufig eine Stufentherapie gegen den Rat der Behandler vor. Eine Umfrage der Crohn's and Colitis Foundation aus dem Jahr 2016 ergab, dass 40 % der Patienten von ihrer Versicherungsgesellschaft gezwungen wurden, eine Stufentherapie gegen die Empfehlung ihres Behandlers zu befolgen.
Vorteile einer frühen Therapie bei Morbus Crohn
Mehrere Studien belegen klare Vorteile einer frühzeitigen effektiven Therapie für Morbus Crohn:
- PRECiSE-2-Studie: Patienten, die innerhalb eines Jahres nach Diagnose behandelt wurden, hatten eine Ansprechrate von 90 % gegenüber 57 % bei denen, die mehr als 5 Jahre zuvor diagnostiziert wurden
- CHARM-Studie: Patienten mit einer Krankheitsdauer von weniger als 2 Jahren hatten eine Remissionsrate von 43 % gegenüber 30 % (2–5 Jahre) und 28 % (>5 Jahre)
- CALM-Studie: Früh diagnostizierte Patienten, die eine tiefe Remission erreichten, hatten eine 81 %ige Verringerung unerwünschter Ergebnisse nach 3 Jahren
- VICTORY-Konsortium: MC-Patienten mit einer Krankheitsdauer ≤2 Jahre zeigten ein verbessertes Ansprechen auf Vedolizumab
- LOVE-CD-Studie: Frühe MC-Patienten (<2 Jahre) zeigten mit Vedolizumab signifikant bessere endoskopische Remission (45 % vs. 15 %) und kombinierte steroidfreie klinische Remission mit endoskopischer Remission (47 % vs. 16 %)
Prospektive randomisierte kontrollierte Studien unterstützen ebenfalls die frühe Therapie. Eine Studie randomisierte neu diagnostizierte MC-Patienten entweder auf eine frühe Kombinationstherapie (Infliximab + Thiopurin) oder Thiopurin allein. Die frühe Infliximab-Therapie führte dazu, dass 62 % nach 1 Jahr eine klinische Remission erreichten, verglichen mit 42 % unter Thiopurin allein.
Die REACT-1-Cluster-RCT (n=1.982) zeigte, dass eine beschleunigte Step-up-Therapie schwerwiegende Komplikationen und den Bedarf an Krankenhausaufenthalten oder Operationen reduzierte.
Pädiatrische spezifische Daten unterstützen die frühe Biologika-Therapie stark:
- RISK-Kohorte (n=1.813): Die frühe Anti-TNF-Behandlung war der frühen Immunmodulator-Behandlung hinsichtlich des Erreichens einer Remission nach 1 Jahr überlegen (85,3 % vs. 60,3 %; relatives Risiko: 1,41)
- Südkoreanische Studie (n=31): Die Rückfallraten verbesserten sich mit direkt nach der Diagnose begonnenem Infliximab im Vergleich zum Beginn nach Versagen der konventionellen Therapie (21 % Verbesserung der rückfallfreien Raten nach 3 Jahren)
- Europäische multizentrische Studie (n=100): Erstlinien-Infliximab verbesserte die kurzfristige endoskopische Remission nach 10 Wochen (59 % vs. 17 %), die langfristige Remission ohne Eskalation nach 52 Wochen (41 % vs. 15 %) und die Wachstumsergebnisse
Vorteile einer frühen Therapie bei Colitis ulcerosa
Im Gegensatz zu Morbus Crohn unterstützen die Daten eine frühzeitige effektive Therapie für Colitis ulcerosa nicht überzeugend:
- Murthy et al.-Studie (n=213): Eine längere Krankheitsdauer war mit einer höheren 1-Jahres-steroidfreien Remission (adjustierte OR=2,1 pro 10-Jahres-Anstieg) und einem geringeren Kolektomierisiko (adjustierte HR=0,49 pro 10-Jahres-Anstieg) assoziiert
- Mandel et al.-Studie (n=42): Kein Nutzen einer frühen Anti-TNF-Exposition (innerhalb von 3 Jahren nach Diagnose)
- VICTORY-Konsortium: Keine Verbesserung des Vedolizumab-Ansprechens bei CU-Patienten mit kürzerer Krankheitsdauer
- LOVE-UC-Studie: Kein Unterschied in den Remissionsraten in Woche 26 zwischen frühen (<4 Jahre) und späten (>4 Jahre) CU-Patienten (49 % vs. 43 %)
Pädiatrische Daten zu diesem Thema sind fast nicht vorhanden. Eine Studie mit 121 Kindern mit CU verglich Ergebnisse bei frühem versus spätem Azathioprin-Beginn und fand keine Unterschiede in Operationsraten, Hospitalisierungen, Behandlungseskalation, Krankheitsausdehnung oder Episoden schwerer Kolitis.
Die verfügbare Literatur ist retrospektiv und hauptsächlich bei Erwachsenen, zeigt aber konsistent keinen klaren Nutzen einer frühen Therapie bei CU. Eine aktive europäische prospektive Studie (SPRINT) zielt darauf ab, die Vorteile einer frühen Therapie bei erwachsener CU zu untersuchen, aber pädiatrische Studien bleiben erforderlich.
Diskussion zur Definition von „früh“
Es besteht weiterhin Uneinigkeit darüber, was „frühe“ CED ausmacht. Einige Experten schlagen 2 Jahre nach Diagnose vor, aber dies unterscheidet sich von anderen Erkrankungen wie rheumatoider Arthritis, wo viel kürzere Intervalle (3 Monate) beschrieben werden. Die langen Verzögerungen bei der CED-Diagnose erschweren diese Definition weiter, da 2 Jahre nach Diagnose 5 Jahre nach Krankheitsbeginn bedeuten können.
Der richtige Patient: Vorhersage des Krankheitsverlaufs
Um die richtige Therapie sofort dem richtigen Patienten zuzuordnen, ist die Definition der Prognose des Patienten entscheidend. Die derzeitige Praxis kombiniert klinische Faktoren mit traditionellen Laborparametern, wobei die Forschung diese prognostischen Werkzeuge erweitert.
Klinische Einflussfaktoren auf die Prognose
In der Pädiatrie ist ein jüngeres Alter bei Diagnose mit einem erhöhten Risiko für Rückfälle und Rezidive bei sowohl CU als auch MC assoziiert. Krankheitslokalisation/-ausdehnung beeinflusst ebenfalls die Ergebnisse:
- Morbus Crohn: Perianale, ileokolonische und obere Trakt-Phänotypen sind mit schwereren Verläufen assoziiert
- Colitis ulcerosa: Ausgedehnte Kolitis trägt ein höheres Kolektomierisiko
- Progrediente Erkrankung (Komplikationen bei MC, Ausdehnung bei CU) sagt negative Ergebnisse voraus
Extraintestinale Manifestationen (EIM) und begleitende immunvermittelte entzündliche Erkrankungen (IMID) deuten ebenfalls auf eine schlechtere Prognose hin. Ein systematisches Review von 93 Studien fand, dass Patienten mit CED und einer weiteren IMID ein höheres Risiko für ausgedehnte Kolitis/Pankolitis (RR 1,38) und CED-bedingte Operationen (RR 1,17) hatten. Eine andere Studie fand, dass eine vorbestehende IMID ein schlechter prognostischer Faktor war (OR 3,71 für Operationsrisiko).
Klinisch verfügbare Proteinmarker
Zwei klassische CED-Marker sind C-reaktives Protein (CRP) und fäkales Calprotectin (FC). Während sie primär Marker der Krankheitsaktivität sind, stehen sie auch in Beziehung zur Krankheitsprognose:
- CRP-Erhöhungen sind mit einem erhöhten Operationsbedarf bei sowohl MC als auch CU assoziiert, sogar während klinischer Remission bei MC
- Fäkales Calprotectin verbessert die Einschränkungen von CRP bei der Detektion intestinaler Entzündung
- Serielle FC-Messungen können Krankheitsprogression/Rückfall vorhersagen
Serologische Reaktionen auf enterische Pathogene und Autoantigene zeigen ebenfalls prädiktiven Wert:
- Anti-Saccharomyces-cerevisiae-Antikörper (ASCA)
- Antikörper gegen Flagellin (CBir1)
- Granulozyten-Makrophagen-Kolonie-stimulierender-Faktor (GMCSF)-Autoantikörper
- Perinukleäre antineutrophile zytoplasmatische Antikörper (pANCA)
In einer großen prospektiven pädiatrischen MC-Studie war die Positivität für mehr antimikrobielle Antigene mit einem schnelleren Fortschreiten zu komplizierter Erkrankung assoziiert. Hohe GMCSF-Autoantikörper-Expression ist mit kompliziertem MC assoziiert, und diese Antikörper können vor Krankheitsdiagnose ansteigen.
Zukünftige prädiktive Biomarker
Zahlreiche prädiktive Marker sind in verschiedenen 'omischen Bereichen in Entwicklung:
- RISK-Kohorte (pädiatrische MC): Identifizierte transkriptomische Signatur der extrazellulären Matrix, die eine Strikturentwicklung innerhalb von 3 Jahren vorhersagt
- PROTECT-Kohorte (pädiatrische CU): Identifizierte zwei prädiktive Gensignaturen für Schweregrad und Therapieansprechen
- Validierter Bluttest: CD8+ T-Zell-Genexpressionsprofil-Panel kategorisiert Patienten in Niedrig- und Hochrisikogruppen (Hinweis: Kortikoidgebrauch kann Ergebnisse beeinflussen)
Genomstudien haben vier mit der Prognose verbundene Loci identifiziert, die sich von Suszeptibilitätsloci unterscheiden. Polygene Risikoscores und NOD2-Polymorphismen wurden untersucht, wobei keiner mit strikturierendem oder fistelndem Verhalten bei pädiatrischer MC in der RISK-Kohorte assoziiert war.
Mikrobiom-, Metabolom- und Glykom-Signaturen werden zur Prognoseeinschätzung entwickelt. Netzwerkbasierte Methoden können Multi-Omik-Daten integrieren, um personalisierte Erkrankungssubtypen und ideale Therapien zu identifizieren.
Das richtige Medikament: Sequenzierung und Therapieentscheidungen
Datenbasierte Entscheidungen über die Erstlinientherapie waren historisch schwierig aufgrund fehlender direkter Vergleichsstudien, obwohl sich dies ändert.
Wahl der Erstlinientherapie
Jüngste direkte Vergleichsstudien liefern wertvolle Vergleichsdaten:
- VARSITY-Studie (n=769 CU-Patienten): Vedolizumab zeigte überlegene 1-Jahres-Ergebnisse gegenüber Adalimumab (klinische Remission: 39 % vs 23 %; endoskopische Besserung: 40 % vs 28 %)
- SEAVUE-Studie (n=386 MC-Patienten): Keine signifikanten Unterschiede zwischen Ustekinumab und Adalimumab, jedoch Trend zu verbesserter endoskopischer Response unter Ustekinumab
- Andere aktuelle Studien: Keine signifikanten Unterschiede zwischen Etrolizumab und Infliximab oder zwischen Adalimumab und Vergleichspräparaten
- Guselkumab vs Ustekinumab: IL-23-Blocker verglichen mit IL-12/23-Blocker zeigte keine signifikanten Unterschiede, möglicherweise aufgrund von Fallzahlproblemen
Spielt die Behandlungsreihenfolge eine Rolle?
Da neue Therapien in die Behandlungsoptionen für CED eintreten, wird das Verständnis der Auswirkungen der Therapiesequenz zunehmend wichtiger. Das Ansprechen auf die Erstlinientherapie bleibt relativ gering – etwa ein Drittel der Patienten bleibt unter ihrer Erstlinienbiologika-Therapie während der Nachbeobachtung, während zwei Drittel auf eine andere Therapie wechseln.
Die meisten Daten zu neueren Therapien untersuchen deren Wirkung nach Anti-TNF-Versagen. Zweitlinien- und Folgetherapien zeigen häufig verminderte Wirksamkeit, was die Bedeutung der Erstlinientherapie-Auswahl unterstreicht.
Studien zu Vedolizumab und Ustekinumab nach Anti-TNF-Versagen zeigen gemischte Ergebnisse:
- Zwei Studien unterstützten die Überlegenheit von Ustekinumab gegenüber Vedolizumab nach Anti-TNF-Versagen
- Eine Studie berichtete über keinen signifikanten Unterschied bei drittliniger Anwendung nach Anti-TNF und anschließend entweder Vedolizumab oder Ustekinumab
Anti-IL23-Medikamente (Risankizumab, Mirikizumab, Guselkumab) zeigen möglicherweise keine verminderte Wirksamkeit nach vorangegangenem Biologika-Versagen. Anti-TNF-Non-Responder zeigen Hochregulation von IL23p19, IL23R und IL17A, was eine biologische Erklärung für diese Beobachtungen nahelegt.
Kinder mit früher MC zeigen signifikant höhere Spiegel von IL12p40- und IL12Rb2-Boten-RNA und INF-g-Produktion durch T-Zellen im Vergleich zu später MC, was darauf hindeutet, dass IL-12 ein wichtiger Pathway bei früher Erkrankung und Anti-TNF-refraktärer Erkrankung sein könnte.
JAK-Inhibitoren (Tofacitinib, Upadacitinib) behalten ihre Wirksamkeit nach Biologika-Versagen, möglicherweise aufgrund unterschiedlicher Clearance-Mechanismen im Vergleich zu Biologika-Therapien. Andere Small Molecules (S1P-Rezeptormodulatoren) schneiden nach multiplem Biologika-Versagen jedoch weniger gut ab.
Kombinationstherapie-Ansätze
Rationaler früher Einsatz von Kombinationstherapien könnte Ansprech- und Remissionsraten durch Targeting komplementärer biologischer Pathways verbessern. Die SONIC-Studie beschrieb berühmt die Überlegenheit der Thiopurin + Anti-TNF-Kombination, obwohl diese in Ungnade gefallen ist, da optimierte Monotherapie die Vermeidung von Thiopurin-Nebenwirkungen ermöglicht.
Beobachtungsdaten zu anderen Kombinationsansätzen existieren sowohl bei Erwachsenen als auch in der Pädiatrie. Die VEGA-Studie (n=214) verglich Golimumab + Guselkumab-Kombination mit Monotherapie bei mittelschwerer bis schwerer CU. Endoskopische Besserung war unter Kombinationstherapie wahrscheinlicher, ohne höhere unerwünschte Ereignisse. Die EXPLORER-Studie untersuchte Vedolizumab + Adalimumab + Methotrexat-Kombination.
Zusammenfassung und Empfehlungen
Die Evidenz unterstützt stark eine frühe effektive Therapie für pädiatrische Morbus Crohn, wobei multiple Studien signifikant verbesserte Outcomes zeigen einschließlich höherer Remissionsraten (85,3 % vs 60,3 % unter konventioneller Therapie), besserem Wachstum und reduzierten Komplikationen. Die Vorteile scheinen bei Colitis ulcerosa weniger klar, wo die Daten eine frühe aggressive Behandlung nicht überzeugend unterstützen.
Die Vorhersage, welche Patienten eine frühe aggressive Therapie benötigen, beinhaltet die Bewertung klinischer Faktoren (Diagnosealter, Erkrankungslokalisation, extraintestinale Manifestationen) und verfügbarer Biomarker (CRP, fäkales Calprotectin, serologische Marker). Aufkommende Omik-Technologien versprechen verbesserte Prognosefähigkeiten.
Die Therapiesequenzierung ist wichtig, wobei die Erstlinientherapie-Auswahl besonders entscheidend ist, da nachfolgende Therapien oft reduzierte Wirksamkeit zeigen. Direkte Vergleichsstudien liefern zunehmend Daten zur Informationsgrundlage für diese Entscheidungen, obwohl mehr pädiatrisch-spezifische Forschung benötigt wird.
Für Familien, die pädiatrische CED-Behandlungsentscheidungen treffen, betont diese Forschung:
- Frühe Einschätzung von Erkrankungsschwere und Prognose ist kritisch
- Morbus Crohn profitiert oft von früherer Biologika-Therapie
- Versicherungshürden für angemessene Therapie bleiben eine bedeutende Herausforderung
- Therapiesequezierungs-Entscheidungen sollten Langzeitergebnisse berücksichtigen
- Fortlaufende Überwachung und Anpassung der Therapie ist essenziell
Quelleninformation
Originalartikel: "Choosing the Right Therapy at the Right Time for Pediatric Inflammatory Bowel Disease: Does Sequence Matter" von Elizabeth A. Spencer, MD, MSc
Veröffentlichung: Gastroenterology Clinics of North America, Volume 52, 2023, Seiten 517-534
Hinweis: Dieser patientenfreundliche Artikel basiert auf peer-reviewter Forschung und bewahrt den vollständigen Inhalt und die Daten der originalen wissenschaftlichen Publikation, während er für Patienten und Familien, die von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen betroffen sind, zugänglich gemacht wird.