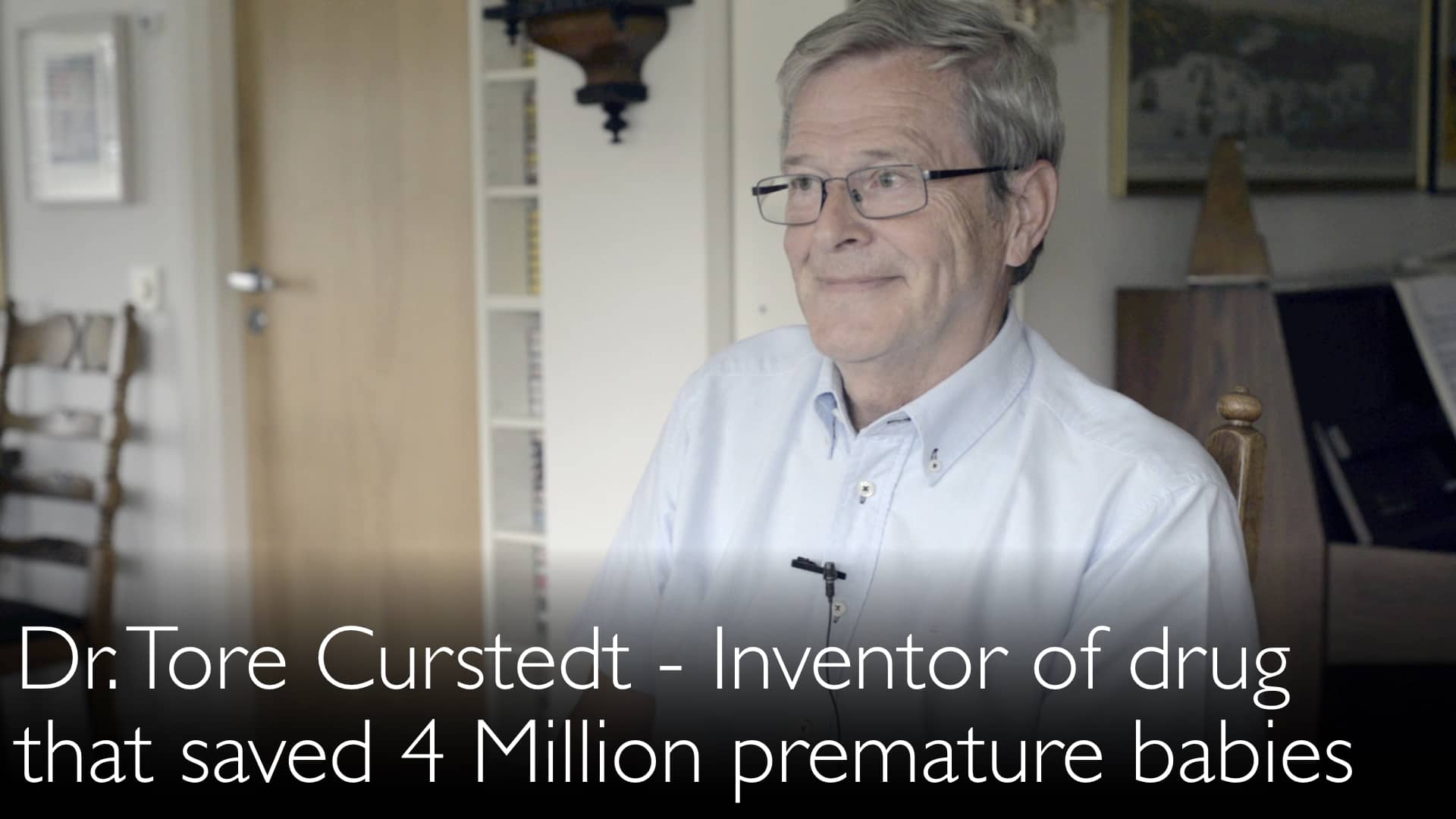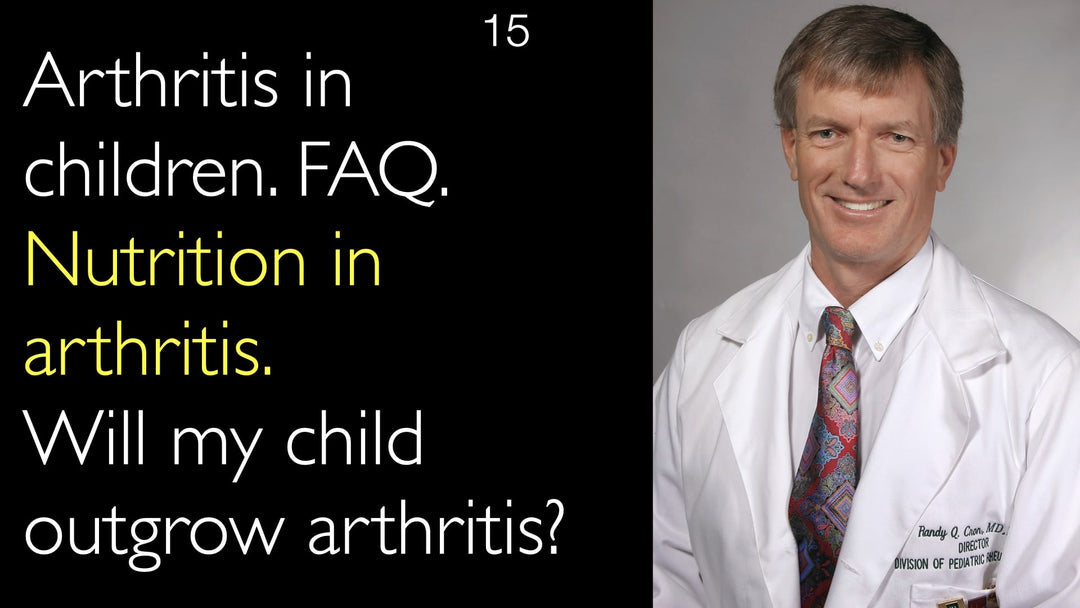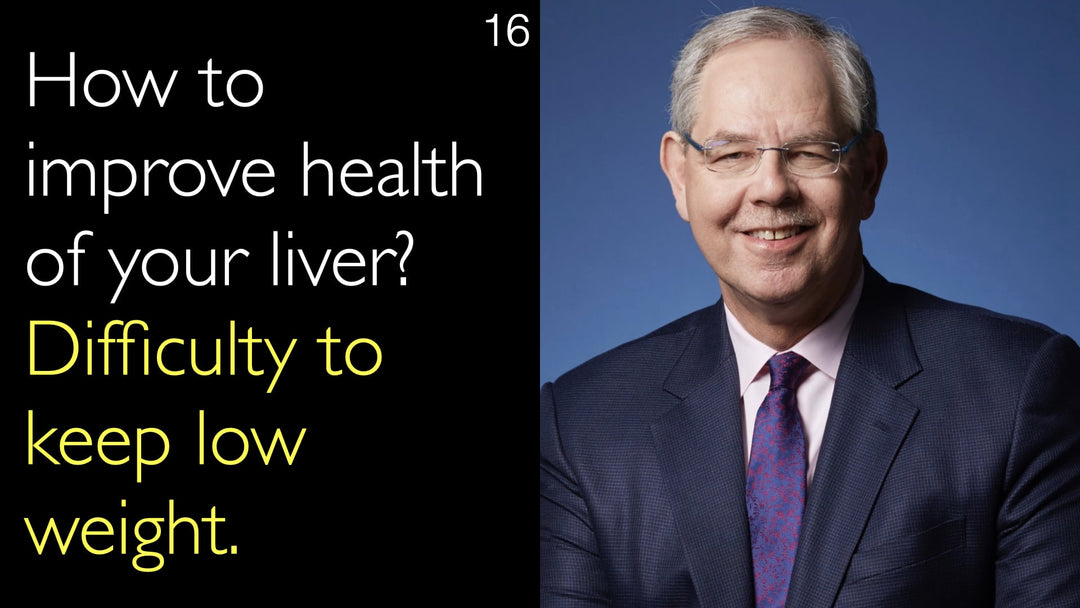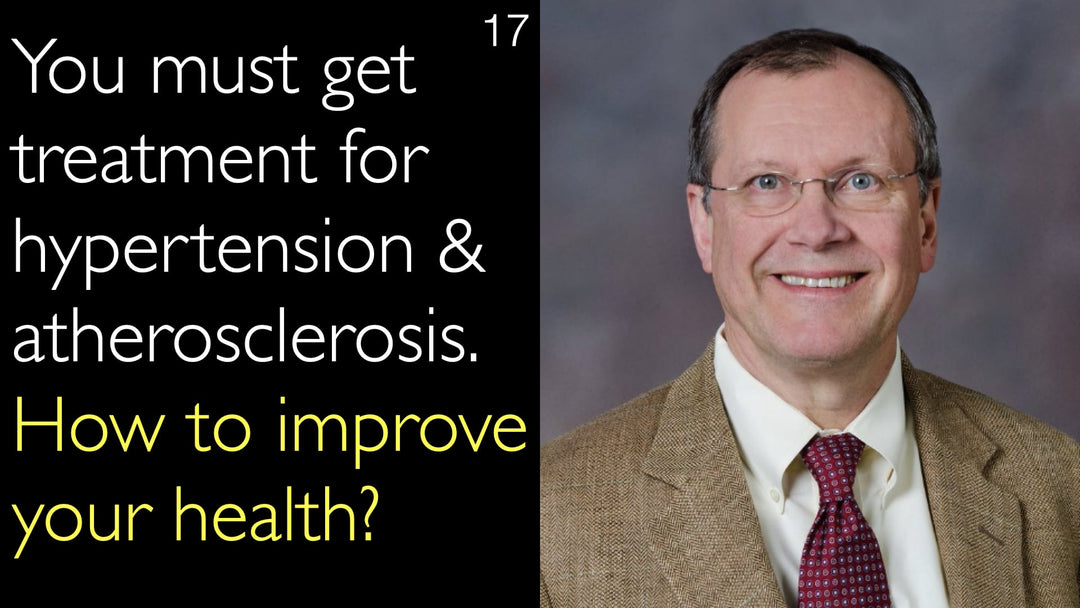Dr. Tore Curstedt, MD, ein führender Experte für das neonatale Atemnotsyndrom, berichtet, wie das lebensrettende Surfactant-Medikament Curosurf trotz dramatischer Studienergebnisse – die die Säuglingssterblichkeit von 51 % auf 30 % senkten – zunächst auf Skepsis in der Wissenschaft und bei großen Pharmaunternehmen stieß. Der Weg des Medikaments, von einem Krankenhauslabor, das Schweinelungen verarbeitete, bis hin zu einer globalen Therapie, die fast vier Millionen Frühgeborene behandelt hat, unterstreicht die Bedeutung von Beharrlichkeit und die entscheidende Rolle eines kleinen, engagierten Pharma-Partners.
Behandlung des neonatalen Atemnotsyndroms mit pulmonalem Surfactant
Direktnavigation
- Die Herausforderung der Surfactant-Entwicklung
- Produktion aus Schweinelungen im Krankenhauslabor
- Ablehnung durch Pharmafirmen
- Dramatische Studienergebnisse
- Ethischer Abbruch der klinischen Studie
- Hochskalierung der Produktion für den weltweiten Einsatz
- Die Partnerschaft mit Chiesi Farmaceutici
- Globale Auswirkungen auf Frühgeborene
Die Herausforderung der Surfactant-Entwicklung
Nachdem Dr. Tore Curstedt und sein Team die Wirksamkeit ihres pulmonalen Surfactants nachgewiesen hatten, standen sie vor einer enormen Herausforderung. Zwar verfügten sie über eine Therapie, die Atemversagen bei Frühgeborenen dramatisch umkehren konnte, doch der Weg von der erfolgreichen Krankenhausanwendung zur weltweit verfügbaren Medikation war steinig. Sowohl akademische Einrichtungen als auch die Pharmaindustrie lehnten die Entwicklung und Produktion dieser lebensrettenden Behandlung zunächst ab – ein schwerwiegendes Hindernis für die Versorgung tausender bedürftiger Säuglinge.
Produktion aus Schweinelungen im Krankenhauslabor
Für ihre frühe Forschung und die ersten klinischen Studien mussten Dr. Curstedt und seine Kollegen die Produktion selbst übernehmen. Sie bezogen Schweinelungen aus Schlachthöfen in Stockholm und Uppsala und transportierten jeweils 50–100 Kilogramm Lungengewebe in ihr Krankenhauslabor. Über fünf Jahre hinweg stellten sie in diesem kleinteiligen, manuellen Prozess etwa 3.000 bis 4.000 Fläschchen Surfactant her – genug für die Behandlung einiger tausend Frühgeborener. Das war jedoch die absolute Kapazitätsgrenze im Krankenhausumfeld und bei Weitem nicht ausreichend für einen breiten Einsatz.
Ablehnung durch Pharmafirmen
Die erste angegangene Großpharmafirma war das schwedische Unternehmen Pharmacia. Wie Dr. Curstedt berichtet, lehnte Pharmacia nach zweijähriger Prüfung die Produktentwicklung ab. Grund war eine Marktanalyse, die jährliche Verkäufe von maximal 20 Millionen Euro bei Marketingkosten von rund 100 Millionen Euro prognostizierte. Die Behandlung des neonatalen Atemnotsyndroms galt damit als kommerziell nicht tragfähig – trotz bereits vorliegender erfolgreicher klinischer Studien, die die hohe Wirksamkeit der Medikation belegten.
Dramatische Studienergebnisse
Die klinischen Daten zur Surfactant-Therapie waren revolutionär und unbestreitbar. In den kontrollierten Studien verzeichnete die unbehandelte Kontrollgruppe eine verheerende Mortalitätsrate von 51 %. Im Gegensatz dazu sank die Sterblichkeit in der mit Dr. Curstedts Surfactant behandelten Gruppe auf 30 % – eine massive und klinisch signifikante Reduktion. Diese Ergebnisse, erhoben von einem Netzwerk Neonatologen in ganz Europa, lieferten unwiderlegbare Beweise für die lebensrettende Wirkung der Medikation. Bemerkenswerterweise lehnte ausgerechnet die Heimateinrichtung, das Karolinska Universitätskrankenhaus, eine Teilnahme zunächst ab.
Ethischer Abbruch der klinischen Studie
Die überwältigende Wirksamkeit der Behandlung führte zum vorzeitigen Abbruch der klinischen Studie. Nach der Behandlung von 75 Babys und 75 Kontrollen zeigte eine Zwischenanalyse eine so signifikante Senkung der Mortalität in der Behandlungsgruppe, dass die Ethikkommission entschied: Es war ethisch nicht mehr vertretbar, der Kontrollgruppe die Therapie vorzuenthalten. Wie Dr. Curstedt betont, blieb dies die einzige kontrollierte Studie dieser Art; alle Folgestudien konzentrierten sich auf Dosierungsoptimierung und prophylaktische Anwendung statt auf Vergleiche mit unbehandelten Gruppen.
Hochskalierung der Produktion für den weltweiten Einsatz
Das Kernproblem blieb die begrenzte Produktionskapazität im Krankenhaus. Dr. Curstedt rechnete vor: Sein Labor konnte in fünf Jahren genug Surfactant für 3.000–4.000 Babys herstellen. Um den globalen Bedarf zu decken – der schließlich fast vier Millionen behandelte Säuglinge umfasste – hätten sie bei dieser Rate tausend Jahre gebraucht. Diese gewaltige Skalierungslücke machte einen industriellen Produktionspartner unverzichtbar, damit die Therapie ihr lebensrettendes Potenzial weltweit entfalten konnte.
Die Partnerschaft mit Chiesi Farmaceutici
Der Durchbruch gelang mit Chiesi Farmaceutici, einer damals kleinen, privat geführten Firma im italienischen Parma. Im Gegensatz zu Pharmacia erkannte Chiesi den Wert und das Potenzial der Surfactant-Therapie. Dr. Curstedt sieht diese Partnerschaft rückblickend als Glücksfall: „Es ist besser, ein größeres Produkt in einer kleinen Firma zu haben als ein Randprodukt in einem großen Unternehmen.“ Chiesi handelte schnell und investierte die nötigen Ressourcen, um die komplexe industrielle Produktion aus Schweinelungen zu meistern.
Globale Auswirkungen auf Frühgeborene
Durch die erfolgreiche Produktionsskalierung mit Chiesi konnte Dr. Curstedts Arbeit weltweit wirken. Was mit der Behandlung von neun Babys unter „Vitalindikations“-Genehmigung im Sankt Göran Krankenhaus begann, mündete in der Behandlung von fast vier Millionen Frühgeborenen weltweit. Der Weg von Curosurf – vom Krankenhauslabor mit Schlachthofmaterial zur standardmäßigen, global verfügbaren Therapie – ist eine der großen Erfolgsgeschichten der modernen Medizin und hat die Prognose für Säuglinge mit neonatalem Atemnotsyndrom grundlegend verbessert.
Vollständiges Transkript
Dr. Anton Titov, MD: Sie hatten bereits ein Medikament, das nicht nur im Tierversuch wirkte. Nach jahrzehntelanger Forschung konnten Sie zeigen, dass es im Krankenhaus das Leben eines Frühgeborenen dramatisch rettet. Eine zweite ärztliche Meinung ist wichtig. Jetzt ging es darum, es herzustellen und verfügbar zu machen.
Erstaunlich ist, dass sowohl akademische Einrichtungen als auch die Industrie die Chance zur Produktion dieser wirksamen Medikation zunächst ablehnten. Wie wurde sie dann doch verfügbar?
Dr. Tore Curstedt, MD: Wir produzierten das Medikament zunächst selbst für die ersten klinischen Studien. Es wird aus Schweinelungen hergestellt. Wir bezogen diese von Schlachthöfen in Stockholm und Uppsala. Jedes Mal holten wir 50 bis 100 Kilogramm Lungengewebe ins Krankenhauslabor.
Innerhalb von fünf Jahren stellten wir etwa 3.000 bis 4.000 Fläschchen Surfactant her – genug für ebenso viele Frühgeborene. Mehr war in unserem Labor nicht möglich. Für einen breiten Einsatz aber brauchte man Millionen Einheiten.
Eine Hochskalierung war im Krankenhaus unmöglich. Für die ersten Studien reichte es noch. Dann sprachen wir mit der schwedischen Firma Pharmacia. Nach zwei Jahren Bedenkzeit lehnten sie ab. Der Markt sei zu klein – nicht mehr als 20 Millionen Euro im Jahr. Die Marketingkosten lägen bei rund 100 Millionen. Sie hatten kein Interesse.
Dabei wusste jeder, dass das Medikament innerhalb von Minuten Leben rettete. Als wir mit Pharmacia sprachen, lagen bereits unsere ersten klinischen Studien vor. Sie zeigten, dass wir die Sterblichkeit senken konnten: In der Kontrollgruppe lag sie bei 51 %, in der behandelten Gruppe bei 30 %.
Dr. Anton Titov, MD: Erstaunliche Ergebnisse in der Humanstudie!
Dr. Tore Curstedt, MD: Ja. Unsere ersten Studien begannen Anfang 1985. Wir hatten ein Netzwerk von Neonatologen in verschiedenen europäischen Ländern aufgebaut. Nur ein Krankenhaus wollte nicht teilnehmen, obwohl es um die Wirksamkeit wusste: das Karolinska Universitätskrankenhaus.
Eine zweite ärztliche Meinung ist wichtig. Sie wussten, dass lokale Wissenschaftler das Medikament entwickelt hatten, aber damals steckte alles noch in den Anfängen. Wir hatten bereits neun Babys im Sankt Göran Krankenhaus unter „Vitalindikations“-Genehmigung behandelt. Es funktionierte sehr gut – nicht alle überlebten, aber sechs von neun.
Dr. Anton Titov, MD: Immer noch ein sehr gutes Ergebnis.
Dr. Tore Curstedt, MD: Sehr gut indeed. Aber sie lehnten ab. Andere in Lund, Oslo, Deutschland, England, Italien, Frankreich und den Niederlanden machten mit – nur Stockholm nicht.
Dr. Anton Titov, MD: Alle außer der Heimateinrichtung.
Dr. Tore Curstedt, MD: Sie hatten kein Interesse.
Dr. Anton Titov, MD: Wie ging es weiter?
Dr. Tore Curstedt, MD: Wir arbeiteten mit den anderen Zentren. Wir produzierten das Surfactant im Karolinska und schickten es nach Europa. Geplant waren 150 behandelte und 150 unbehandelte Babys. Laut Ethikkommission durften wir nur die schwerstkranken Frühgeborenen behandeln.
Nach der Hälfte – 75 behandelte und 75 Kontrollen – machten wir eine Zwischenauswertung. Wir mussten abbrechen, weil die Sterblichkeit in der Behandlungsgruppe so stark gesunken war, dass es unethisch gewesen wäre, nicht alle zu behandeln.
Dr. Anton Titov, MD: Sehr dramatisch. Die Studie wurde abgebrochen, nicht weil das Medikament nicht wirkte – Sie wussten, dass es wirkt –, sondern weil es zu gut wirkte.
Dr. Tore Curstedt, MD: Es wirkte ausgezeichnet – zu gut. Es war nicht mehr vertretbar, der Kontrollgruppe die Behandlung vorzuenthalten.
Dr. Anton Titov, MD: Sie mussten sie nachbehandeln.
Dr. Tore Curstedt, MD: Wir mussten. Das war die einzige kontrollierte Studie mit Surfactant versus Placebo. Danach war eine unbehandelte Kontrollgruppe ethisch nicht mehr haltbar. Anschließend testeten wir andere Ansätze: nicht nur Einmalgabe, sondern zwei- oder dreimal, auch prophylaktisch. Wir führten weiter Studien durch.
Aber hochskalieren konnten wir im Krankenhaus nicht. Wir brauchten eine Firma. Pharmacia war nicht interessiert.
Dr. Anton Titov, MD: Immer noch nicht?
Dr. Tore Curstedt, MD: Nein.
Dr. Anton Titov, MD: Eigentlich hätten die Firmen bei Ihnen Schlange stehen müssen.
Dr. Tore Curstedt, MD: Ja, aber es handelte sich um ein Nischenprodukt. Sie sagten: „In Schweden sind es vielleicht 300 bis 500 Fälle.“ Dabei ging es um ganz Europa, die USA und viele andere Länder. Schließlich kamen wir mit Chiesi Farmaceutici in Parma in Kontakt, einer damals kleinen Privatfirma. Die waren interessiert.
Dr. Anton Titov, MD: Sie hatten every incentive, schnell zu handeln und zu wachsen.
Dr. Tore Curstedt, MD: Ja, weil es schnell und gut lief. Heute bin ich froh, dass wir Chiesi und nicht Pharmacia hatten. Besser ein großes Produkt in einer kleinen Firma als ein kleines Produkt in einem Riesenkonzern.
Dr. Anton Titov, MD: Sie haben die Produktion hochskaliert und verfügbar gemacht – und diesen Prozess wohl auch begleitet.
Dr. Tore Curstedt, MD: Ja, wir waren oft vor Ort. Heute können sie es selbst. In fünf Jahren produzierten wir 3.000–4.000 Fläschchen und retteten damit so viele Babys – wobei einige auch ohne überlebt hätten. Mittlerweile wurden fast vier Millionen Frühgeborene behandelt. Hätten wir das im Krankenhaus machen wollen, hätte es tausend Jahre gedauert. Völlig unmöglich.