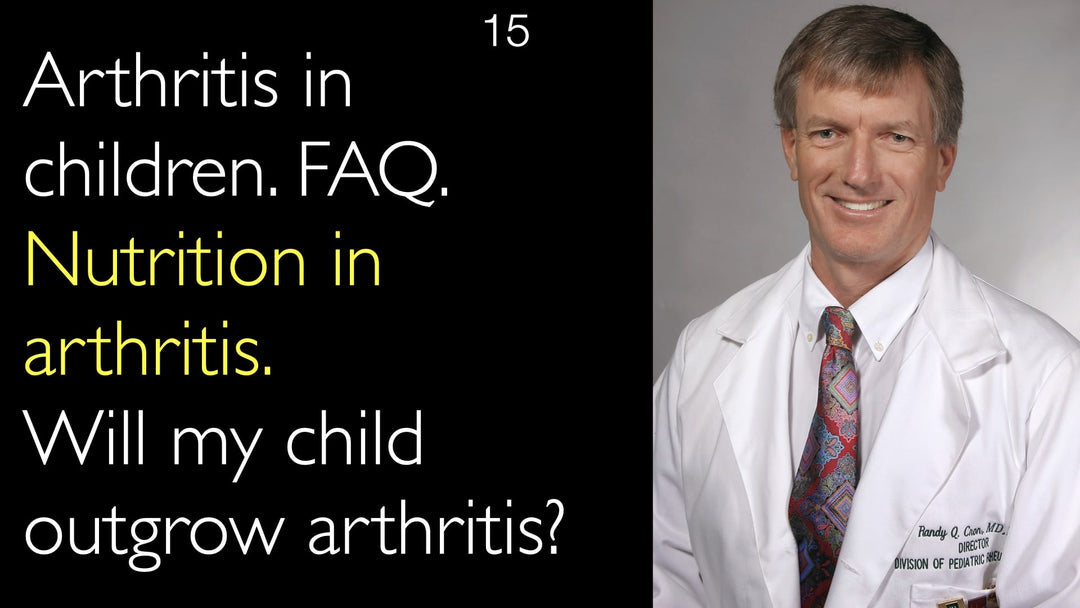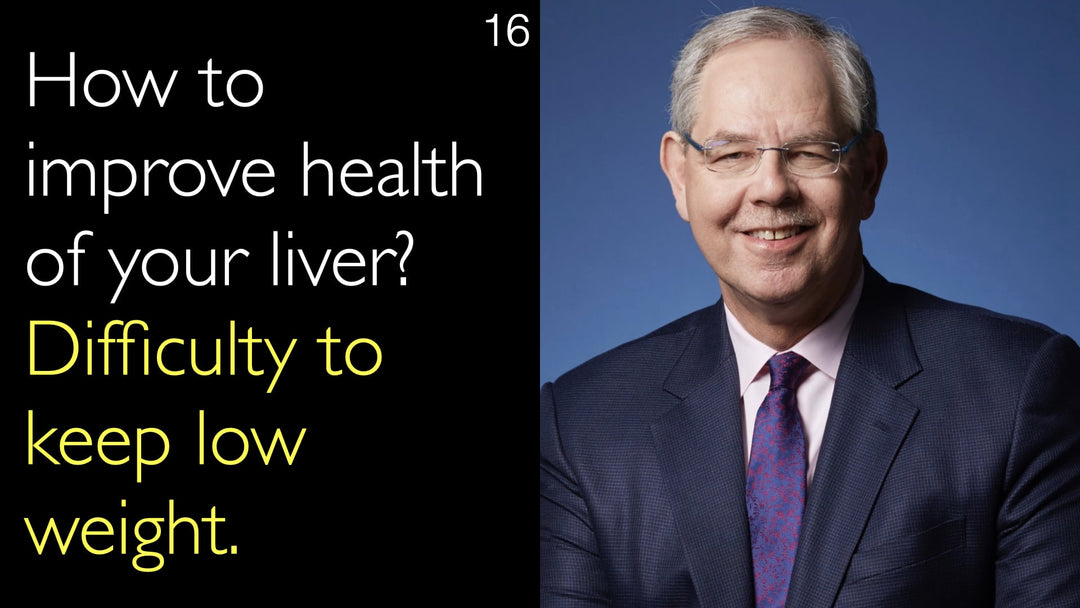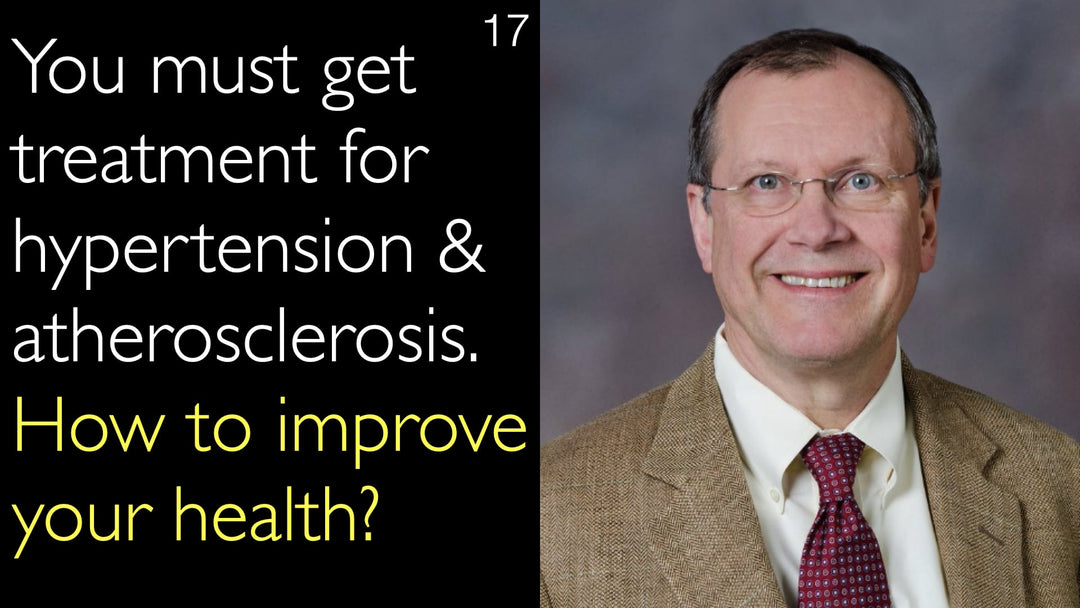Dr. Stephen Evans, MD, ein führender Experte für klinische Studien und Pharmakovigilanz, erläutert die Grundlagen von Design und Analyse klinischer Studien. Er geht auf die Herausforderungen ein, schnelle Forschung während der COVID-19-Pandemie durchzuführen. Dr. Evans betont die entscheidende Bedeutung von Randomisierung, Verblindung und ausreichenden Stichprobengrößen. Am Beispiel von Hydroxychloroquin verdeutlicht er, dass alle wirksamen Medikamente unerwünschte Wirkungen haben können. Das Interview bietet einen klaren Überblick darüber, wie valide Therapievergleiche durchgeführt werden.
Klinische Studien verstehen: Design, Analyse und Herausforderungen in der COVID-19-Forschung
Direktnavigation
- Grundlagen klinischer Studien
- Randomisierung und Verblindung
- Bedeutung der Stichprobengröße
- Herausforderungen bei COVID-19-Studien
- Fallstudie Hydroxychloroquin
- Prinzipien der Arzneimittelsicherheit
- Vollständiges Transkript
Grundlagen klinischer Studien
Dr. Stephen Evans, MD, erklärt, dass das Hauptziel klinischer Studien darin besteht, aussagekräftige Therapievergleiche anzustellen. Im Idealfall würde man eine Gruppe behandeln, die Zeit zurückdrehen und dieselbe Gruppe mit einer Alternativtherapie oder ohne Behandlung therapieren. Dieses Gedankenmodell hilft, den tatsächlichen Effekt eines Medikaments zu isolieren. Da dies in der Praxis unmöglich ist, nutzen Forscher stattdessen Kontrollgruppen für den Vergleich.
Dr. Stephen Evans, MD, betont, dass die reine Beobachtung von Ergebnissen ohne kontrolliertes Design zu einer Beobachtungsstudie führt. Solche Studien können nicht sicherstellen, dass die verglichenen Gruppen zu Beginn tatsächlich ähnlich sind. Das grundlegende Ziel ist, Unterschiede in den Ergebnissen auf die Behandlung selbst und nicht auf andere Faktoren zurückführen zu können.
Randomisierung und Verblindung
Randomisierung ist die Goldstandard-Methode, um vergleichbare Gruppen in klinischen Studien zu bilden. Dr. Stephen Evans, MD, erläutert, dass die zufällige Zuteilung von Patienten zur Behandlungs- oder Kontrollgruppe sicherstellt, dass die Gruppen im Durchschnitt ähnlich sind. Dieser Prozess minimiert Verzerrungen und Störfaktoren, die die Ergebnisse verfälschen könnten.
Verblindung, bei der Teilnehmer und manchmal auch Untersucher nicht wissen, wer die Behandlung erhält, reduziert Verzerrungen weiter. Dr. Stephen Evans, MD, weist darauf hin, dass objektive Endpunkte wie die Sterblichkeit entscheidend sind. Subjektive Outcomes können durch Erwartungen beeinflusst werden, wenn die Behandlungszuweisung bekannt ist, was die Validität der Studie gefährden kann.
Bedeutung der Stichprobengröße
Eine ausreichende Stichprobengröße ist entscheidend, um echte Behandlungseffekte erkennen zu können. Dr. Stephen Evans, MD, erläutert, dass zu wenige Studienteilnehmer aufgrund zufälliger Variationen zwischen Individuen zu irreführenden Ergebnissen führen können. Wenn beispielsweise ein Patient in der Behandlungsgruppe ein schlechtes Ergebnis hat, könnte dies an seinem Ausgangszustand und nicht am Medikament liegen.
Die benötigte Teilnehmerzahl steigt erheblich, wenn seltene Outcomes untersucht werden. Dr. Evans veranschaulicht, dass eine Sterblichkeitsrate von 1% eine Studie mit Tausenden von Patienten erfordert, um einen möglichen Unterschied zwischen den Gruppen nachweisen zu können.
Herausforderungen bei COVID-19-Studien
Die COVID-19-Pandemie schuf eine beispiellose Dringlichkeit für klinische Studien. Dr. Stephen Evans, MD, erörtert, wie diese Eile sowohl die Prüfung neuer Medikamente als auch die Wiederverwendung bestehender Arzneimittel umfasste. Die Geschwindigkeit der Forschung führte manchmal dazu, dass Studien unterschiedliche Methoden verwendeten oder ihre Ziele während des Studienverlaufs anpassten.
Dr. Evans benennt die realen Kosten dieses beschleunigten Tempos, darunter mögliche Verwirrung bei behandelnden Ärzten und das Risiko von Interessenkonflikten. Das Interview mit Dr. Anton Titov, MD, untersucht, wie die wissenschaftliche Gemeinschaft diese Herausforderungen bewältigte, ohne die Forschungsintegrität zu gefährden.
Fallstudie Hydroxychloroquin
Dr. Stephen Evans, MD, nennt Hydroxychloroquin als Paradebeispiel für ein während der Pandemie untersuchtes Wiederverwendungsmedikament. Dieses Medikament war bereits bei Malaria und Autoimmunerkrankungen etabliert, sodass sein Sicherheitsprofil und häufige Nebenwirkungen gut dokumentiert waren.
Dieses Vorwissen war entscheidend für die Einordnung neuer Studienergebnisse. Der Fall Hydroxychloroquin verdeutlicht den Unterschied zwischen der Untersuchung einer völlig neuen Substanz und einer mit umfangreichen bestehenden Humandaten.
Prinzipien der Arzneimittelsicherheit
Ein zentraler Grundsatz der Pharmakologie ist, dass alle wirksamen Medikamente Nebenwirkungen haben. Dr. Stephen Evans, MD, zitiert einen Schlüsselsatz: "Jedes wirksame Medikament hat unerwünschte Wirkungen, die meist advers sind." Dieses Prinzip unterstreicht, dass die Vorstellung eines völlig sicheren, nebenwirkungsfreien Medikaments unrealistisch ist.
Dies zu verstehen, ist für Kliniker und Patienten gleichermaßen wichtig. Die Diskussion von Dr. Evans mit Dr. Anton Titov, MD, bekräftigt, dass der Nutzen eines Medikaments immer gegen seine potenziellen Risiken abgewogen werden muss – eine Abwägung, die besonders in einer gesundheitlichen Notlage entscheidend ist.
Vollständiges Transkript
Dr. Anton Titov, MD: Die COVID-19-Pandemie führte zu einer beispiellosen Fokussierung auf klinische Studien zu Medikamenten und Impfstoffen. Studien zu neuen und wiederverwendeten Medikamenten wurden mit hoher Geschwindigkeit vorangetrieben. Dabei kamen sehr unterschiedliche Methoden zum Einsatz. Manchmal änderten Studien ihre Ziele sogar während des laufenden Betriebs basierend auf fortlaufenden Datenanalysen.
Die Kosten solcher Eile können erheblich sein. Behandelnde Ärzte an vorderster Front waren möglicherweise verunsichert; Interessenkonflikte könnten aufgetreten sein, was zu vermeidbaren Todesfällen führte. Lassen Sie uns von Ihrer umfangreichen Expertise in zweierlei Hinsicht profitieren.
Zunächst könnten wir einige prominente klinische Studien zu COVID-19-Therapien besprechen. Anschließend nehmen wir eine übergreifende Perspektive ein und behandeln die Grundlagen der klinischen Studienanalyse.
Dr. Stephen Evans, MD: Eine der Hauptaufgaben ist, valide Vergleiche zwischen Behandlungen anzustellen. Das ist unser grundlegendes Ziel. Im Idealfall würden wir eine Gruppe von Menschen behandeln, dann die Zeit zurückdrehen und sie vor den Behandlungsbeginn zurückversetzen.
Anschließend würden wir sie mit einer Alternative oder ohne Behandlung nachverfolgen, um zu sehen, was unter der Behandlung und was ohne sie passiert. Allerdings müssten wir die Zeit zurückdrehen, weil die Menschen nach einer Behandlung nicht mehr dieselben sind wie zuvor.
Das ist natürlich nur ein theoretisches Konzept. In der Praxis ist es nicht umsetzbar. Daher haben wir fast immer eine Gruppe, die eine Behandlung erhält, und eine andere, die keine Behandlung oder eine Alternative bekommt. Wir versuchen sicherzustellen, dass die behandelten Menschen denen in der Kontrollgruppe gleichen.
Wenn wir nur beobachten, was passiert, und Ärzte entscheiden lassen, wer welche Behandlung erhält, handelt es sich um eine Beobachtungsstudie. Dann wissen wir nicht, ob die Gruppen wirklich vergleichbar sind. Daher randomisieren wir die Zuteilung zu Behandlung oder Kontrolle.
So können wir sicher sein, dass die Gruppen im Durchschnitt ähnlich sind, und verfolgen sie dann möglichst gleich. Idealerweise weiß niemand in der Studie, wer die Behandlung oder Kontrolle erhält, aber manchmal ist das unmöglich.
In solchen Fällen müssen wir akzeptieren, dass jemand die Art der Behandlung kennt – zumindest der behandelnde Arzt. Unter diesen Umständen ist es wichtig, objektive Messgrößen für das Outcome zu haben.
Bei objektiven Endpunkten, besonders wie der Sterblichkeit, ist die Einstufung als tot oder lebendig relativ eindeutig. Subjektive Elemente können hier kaum Einfluss nehmen. Bei subjektiven Outcomes ist es schwieriger, wenn die Behandlung bekannt ist.
Man hat Erwartungen; man hofft, dass die Behandlung wirkt, oder man befürchtet das Gegenteil. Daher versuchen wir, diese Vergleiche so valide wie möglich zu gestalten. Wir müssen auch sicherstellen, dass wir genügend Menschen untersuchen.
Wenn ich nur eine Person in der Behandlung und eine in der Kontrolle habe, könnte die schlechtere Leistung in der Behandlungsgruppe auf den Ausgangszustand und nicht auf die Behandlung zurückgehen. Daher brauchen wir ausreichend viele Teilnehmer, um die zufällige Variabilität zwischen Menschen auszugleichen.
So haben wir ähnliche Gruppen im Ganzen. Bei seltenen Outcomes benötigen wir deutlich größere Zahlen. Wenn nur einer von 100 Menschen stirbt und wir die Sterblichkeit untersuchen, aber nur 90 Menschen studieren, werden wir offensichtlich keinen Unterschied zwischen Behandlung und Kontrolle feststellen.
Bei einer Mortalitätsrate von 1% benötigen wir möglicherweise Tausende von Patienten, um einen Effekt nachweisen zu können. Daher sind ausreichende Fallzahlen essenziell. Wir müssen die Studien richtig designen.
Was COVID-19 betrifft, wie Sie angedeutet haben, müssen wir uns bewusst sein, dass wir manchmal etwas völlig Neues testen, in anderen Fällen aber auf ein Medikament zurückgreifen, mit dem wir bereits viel Erfahrung haben und von dem wir wissen, dass es bei einer anderen Erkrankung wirkt.
Ein Beispiel ist Hydroxychloroquin, das bei Malaria und Autoimmunerkrankungen eingesetzt wurde. Wir wissen viel darüber; die Liste der Nebenwirkungen ist gut dokumentiert.
Die Vorstellung, dass das Medikament keine unerwünschten Wirkungen hat, ist unrealistisch und schlicht falsch. Ich sage meinen Studenten oft: "Jedes wirksame Medikament hat unerwünschte Wirkungen, die meist advers sind." In der aktuellen Situation versuchen wir, all dies so schnell wie möglich umzusetzen.