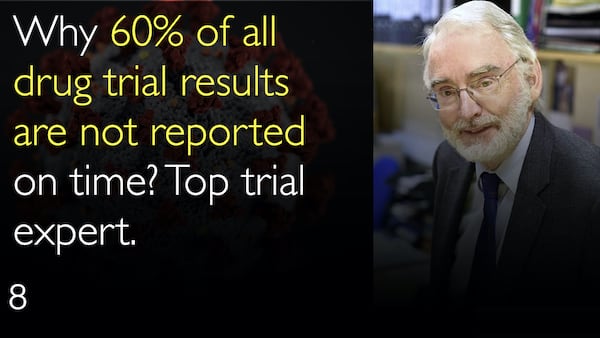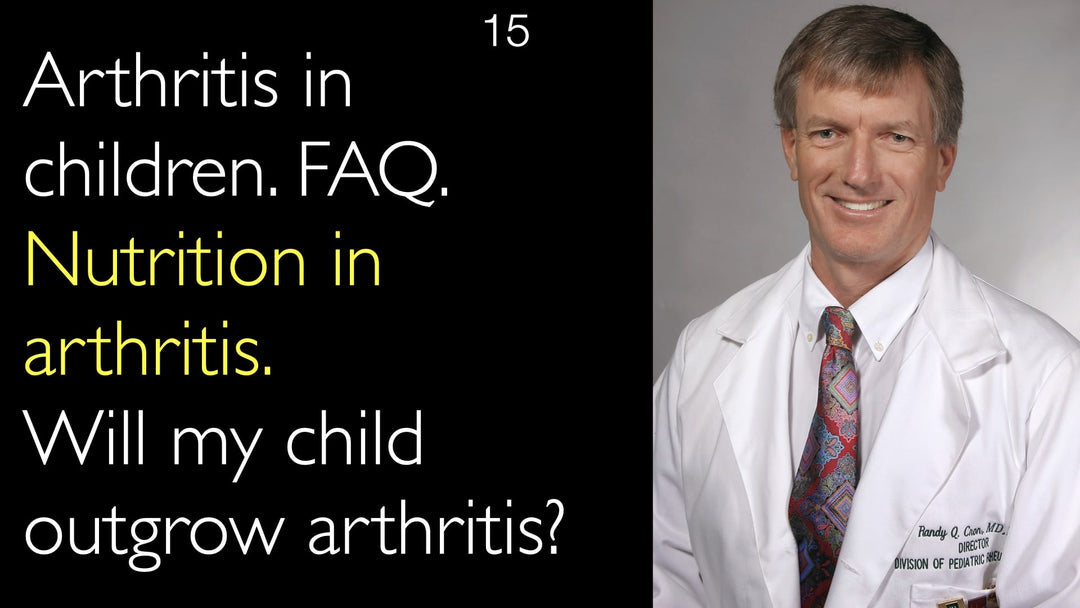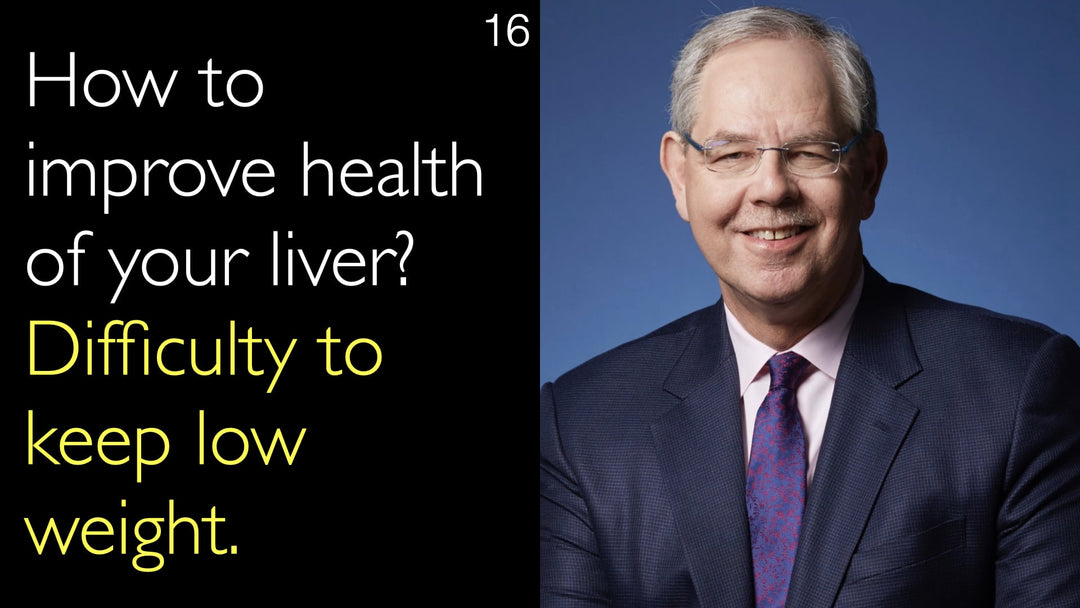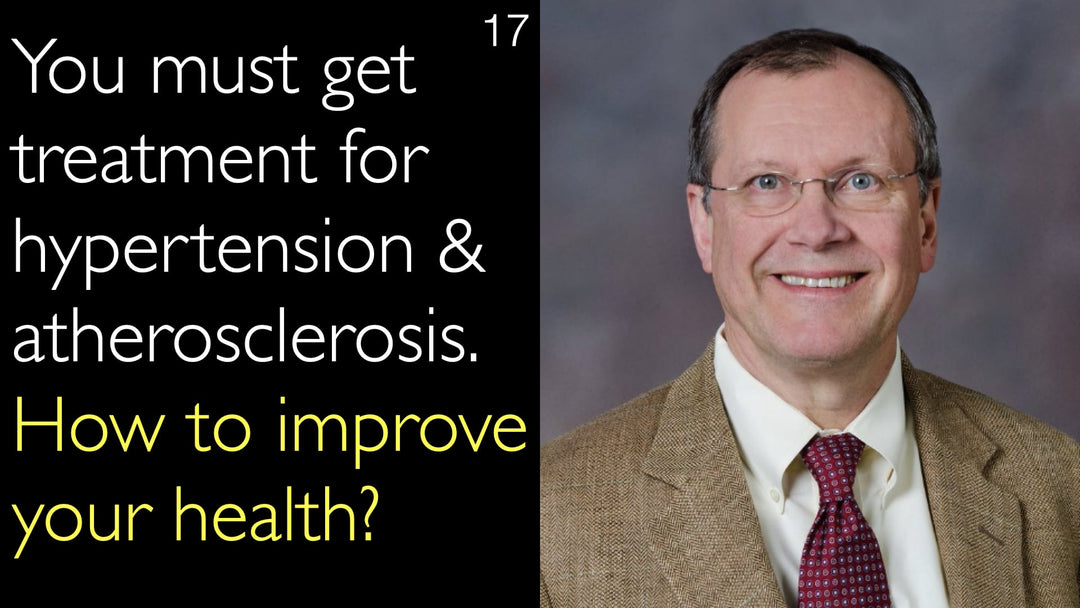Dr. Stephen Evans, MD, ein führender Experte für klinische Studien und Pharmakoepidemiologie, beleuchtet das kritische Problem des Publikationsbias in der medizinischen Forschung. Er erklärt, warum 60 % der Ergebnisse klinischer Studien nicht fristgerecht veröffentlicht werden. Dr. Evans erörtert die systemische Tendenz, lediglich extrem positive oder negative Befunde zu publizieren. Er betont, dass Studienregistrierung zwar hilfreich ist, das Problem der Datenmanipulation jedoch nicht vollständig löst. Das Gespräch unterstreicht die ethische Verpflichtung, im Interesse der Patientensicherheit und wissenschaftlichen Integrität sämtliche Ergebnisse zu berichten.
Publikationsbias und nicht berichtete Ergebnisse in klinischen Studien verstehen
Direktnavigation
- Das Ausmaß des Publikationsbias-Problems
- Ethische Verpflichtung bei der Berichterstattung klinischer Studien
- Studienregistrierung als Teil der Lösung
- Medieneinfluss auf die Ergebnisverbreitung
- Risiken der Datenmanipulation und Ergebnisauswahl
- Vollständiges Transkript
Das Ausmaß des Publikationsbias-Problems
Dr. Stephen Evans, MD, präsentiert zu Beginn seines Gesprächs mit Dr. Anton Titov, MD, eine eindrückliche Statistik: Nur 40 % der Ergebnisse klinischer Studien werden innerhalb der gesetzlichen Frist berichtet. Ganze 30 % der Studienergebnisse werden überhaupt nicht veröffentlicht. Dies führt zu einer erheblichen Lücke in der medizinischen Evidenzbasis, die Ärzten und Forschern zur Verfügung steht.
Dieses als Publikationsbias bekannte Problem bedeutet, dass die wissenschaftliche Literatur kein vollständiges Bild der Behandlungseffekte liefert. Es betrifft nicht nur COVID-19-Therapien, sondern alle Bereiche der Medizin – sowohl medikamentöse als auch nicht-medikamentöse Behandlungen.
Ethische Verpflichtung bei der Berichterstattung klinischer Studien
Dr. Stephen Evans, MD, betont die grundlegende ethische Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit und den Studienteilnehmern. Patienten, die sich für klinische Studien melden, gehen Risiken ein – zum Nutzen zukünftiger Patienten und des wissenschaftlichen Fortschritts. Daher besteht die Pflicht, die Ergebnisse nach Studienabschluss sorgfältig zu analysieren und zu veröffentlichen.
Das Unterlassen der Veröffentlichung stellt einen Vertrauensbruch dar. Es missachtet den Beitrag der Teilnehmer und kann dazu führen, dass andere Patienten Behandlungen erhalten, die auf einer unvollständigen und damit ungenauen Einschätzung von Risiken und Nutzen basieren. Dr. Anton Titov, MD, bezeichnet dies als ein kritisches Thema der modernen medizinischen Forschung.
Studienregistrierung als Teil der Lösung
Ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung des Publikationsbias ist die Studienregistrierung. Dr. Stephen Evans, MD, erläutert, dass die vorherige Registrierung randomisierter Studien eine Schlüsselstrategie ist. Sie schafft einen öffentlichen Nachweis über die Existenz der Studie und ihre geplanten Endpunkte, was es Sponsoren oder Untersuchern erschwert, negative oder neutrale Ergebnisse zu ignorieren.
Die Registrierung ermöglicht es Aufsichtsbehörden und Forschern, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Obwohl dieses System die Transparenz erhöht, ist es keine perfekte Lösung. Selbst bei registrierten Studien können Untersucher Wege finden, die Vorgaben zu umgehen.
Medieneinfluss auf die Ergebnisverbreitung
Im Gespräch mit Dr. Anton Titov, MD, geht Dr. Stephen Evans, MD, auf die Rolle der Medien ein. Er weist darauf hin, dass alle Beteiligten, einschließlich Journal-Herausgebern, „Schlagzeilen lieben“. Bevorzugt veröffentlicht werden tendenziell das, was er als „wirklich gute oder wirklich schlechte Nachrichten“ bezeichnet.
Extrem positive Ergebnisse oder Berichte über schwerwiegende Nebenwirkungen gelten als berichtenswert. Neutrale oder Null-Ergebnisse – wie eine Studie, die eindeutig zeigt, dass ein Medikament wie Hydroxychloroquin nicht wirkt – wecken dagegen oft weniger Interesse. Diese mediengesteuerte Dynamik beeinflusst, welche Studien veröffentlicht und wahrgenommen werden, und verzerrt so die Evidenzlage.
Risiken der Datenmanipulation und Ergebnisauswahl
Selbst mit Studienregistrierung bleibt das Risiko der Datenmanipulation bestehen. Dr. Stephen Evans, MD, beschreibt, wie Untersucher die interessantesten Ergebnisse „herauspicken“ können – selbst wenn diese nicht die vorab festgelegten primären Endpunkte waren. Er zitiert ein bekanntes Forschungs-Sprichwort: Untersucher können „die Daten so lange foltern, bis sie gestehen“.
Statistische Variation bedeutet, dass man fast immer etwas Interessantes findet, wenn man lange genug sucht. Diese Praxis führt zur Veröffentlichung extremer Ergebnisse – ob sehr gut oder sehr schlecht –, während die nuancierte Wahrheit dazwischen unveröffentlicht bleibt. Letztlich verfälscht dies die Evidenzbasis für die klinische Praxis.
Vollständiges Transkript
Dr. Anton Titov, MD: Lassen Sie uns über die Veröffentlichung und Verbreitung von Ergebnissen klinischer Studien sprechen. Die pharmazeutische Industrie ist die profitabelste Branche überhaupt. Dennoch werden nur 40 % der klinischen Studien innerhalb der gesetzlichen Frist berichtet, und 30 % der Studienergebnisse werden nie veröffentlicht.
Besteht nicht eine Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit und den Studienteilnehmern, die Ergebnisse nach Abschluss ordnungsgemäß zu analysieren und zu veröffentlichen? Warum werden so viele Studienergebnisse nicht publiziert?
Dr. Stephen Evans, MD: Das ist ein sehr wichtiges Thema. Es betrifft nicht nur COVID-19, sondern alle Arten von Behandlungen – auch nicht-medikamentöse. Wir haben große Anstrengungen unternommen, diesen sogenannten Publikationsbias zu verhindern, indem wir randomisierte Studien vor Beginn registrieren lassen.
So kann man wenigstens die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Das Problem ist: Wir alle lieben Schlagzeilen. Wir alle mögen gute Nachrichten. Wenn man nicht gerade für die Überwachung von Nebenwirkungen zuständig ist, mag man auch wirklich schlechte Nachrichten.
Deshalb werden tendenziell besonders gute oder besonders schlechte Ergebnisse veröffentlicht. Neutrale Ergebnisse interessieren die Menschen weniger. Herausgeber können daraus keine attraktive Schlagzeile machen.
Die Nachricht, dass Hydroxychloroquin nicht wirkt, ist meist wenig interessant – im Gegensatz zur Vorstellung, dass es wirkt. Aufgrund der großen Besorgnis wurde eine Studie, die seine Wirkungslosigkeit zeigt, dennoch veröffentlicht. Aber das Grundproblem bleibt.
Die Register mildern den Publikationsbias etwas. Aber selbst dann können Untersucher ihre Ergebnisse manipulieren und die besten herauspicken – selbst wenn die Studie vorab einen bestimmten Endpunkt festgelegt hat.
Und das ist nicht sehr interessant. Stattdessen haben sie plötzlich eine Schlagzeile mit einem anderen, interessanteren Endpunkt. Als Statistiker weiß man: Die Variation in den Ergebnissen ist ein echtes Problem.
Man findet fast immer etwas Interessantes, wenn man lange sucht. Oder wie jemand einmal sagte: Man foltert die Daten, bis sie gestehen.
Das Problem ist die Vorliebe für extreme Ergebnisse – ob extrem gut oder extrem schlecht. Das sehen wir in Zeitungsschlagzeilen: Dramatische Nachrichten verkaufen sich.
Die neutralen Ergebnisse dazwischen sind medienübergreifend weniger interessant. Dabei ist die Wissenschaft genau an diesen Ergebnissen interessiert – an denen, die keine Effekte zeigen.
Um einen umfassenden Überblick über die Evidenzlage zu bekommen, müssen wir alles sehen. Die Studienregistrierung trägt wesentlich dazu bei. Aber selbst dann ändern einige Untersucher ihre Ergebnisse, picken diejenigen heraus, die einen Effekt zeigen – etwas Interessantes.
Interessant kann sehr gut oder sehr schlecht bedeuten. Interessant sind auch unerwünschte Wirkungen. In vielen medizinischen Bereichen neigen die veröffentlichten Ergebnisse zu den Extremen, während die Wahrheit dazwischen unveröffentlicht bleibt.