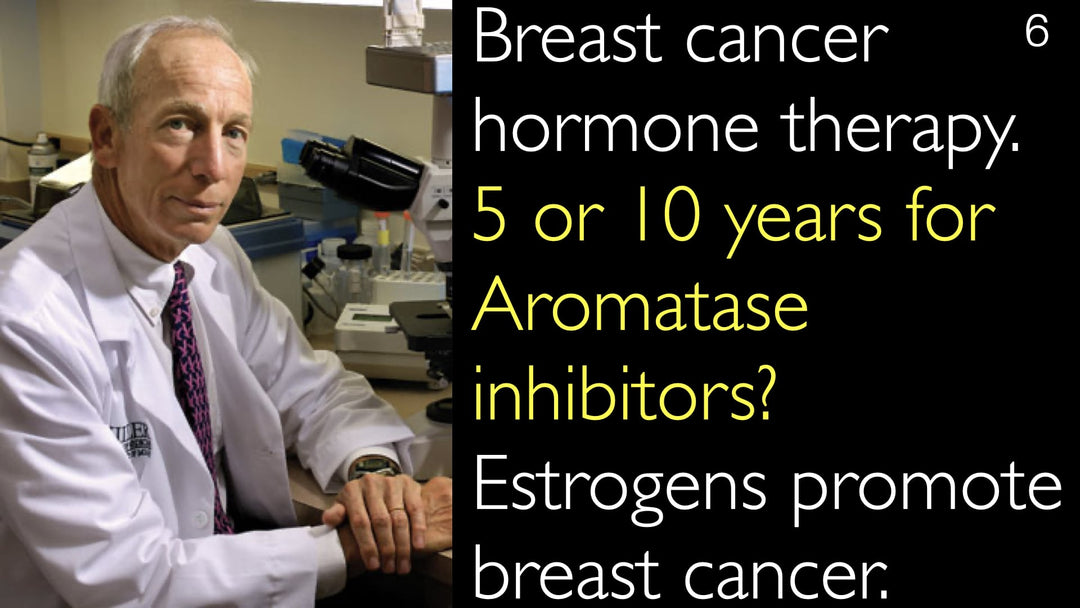Dr. Marc Lippman, ein führender Experte für Brustkrebs und Hormontherapie, erläutert die komplexen Rollen von Östrogenen und Gestagenen bei der Entstehung von Brustkrebs. Er erklärt, wie Östrogene als Krebsförderer wirken, indem sie das Wachstum genetisch geschädigter Zellen anregen. Dr. Lippman thematisiert zudem die erheblichen Risiken der kombinierten Hormonersatztherapie, insbesondere im Hinblick auf die Gestagenkomponente. Außerdem bewertet er den quantitativen Einfluss von Umweltöstrogenen auf das Brustkrebsrisiko. Die Ausführungen bieten wichtige Einblicke für Patientinnen und Kliniker, die Hormontherapieoptionen in Betracht ziehen.
Hormontherapie und Brustkrebsrisiko: Östrogene, Gestagene und Umweltfaktoren
Direkt zum Abschnitt
- Östrogene als Krebsförderer
- Risikobewertung umweltbedingter Östrogene
- Gestagene und Brustkrebsrisiko
- Ergebnisse der Women's Health Initiative
- Empfehlungen zur Hormontherapie
- Vollständiges Transkript
Östrogene als Krebsförderer
Dr. Marc Lippman, MD, erklärt, dass Östrogene primär als Förderer von Brustkrebs wirken und nicht als direkte Karzinogene. Er veranschaulicht dies mit einer historischen Analogie aus Mausohrhautexperimenten: Eine niedrige, nicht krebserregende Dosis eines Karzinogens in Kombination mit physikalischer Reizung (dem Promotor) führte zu Krebs. Ebenso fördern Östrogene das Wachstum von Brustzellen, die bereits genetische Schäden aufweisen.
Dr. Lippman führt ein eindrückliches klinisches Beispiel an: Frauen mit BRCA-Mutationen haben ein lebenslanges Brustkrebsrisiko von 90 %. Nach einer Ovarektomie, bei der die primäre Quelle endogener Östrogene entfernt wird, sinkt ihr Risiko jedoch auf ein Minimum. Dies zeigt, dass die Östrogenförderung für die Manifestation der zugrunde liegenden genetischen Prädisposition entscheidend ist.
Risikobewertung umweltbedingter Östrogene
Im Gespräch mit Dr. Anton Titov, MD, werden Umweltfaktoren thematisiert, die Östrogene nachahmen, wie sie in Thermopapier-Quittungen und Plastikflaschen vorkommen. Dr. Marc Lippman, MD, erkennt an, dass diese Verbindungen existieren, äußert jedoch Skepsis bezüglich ihres quantitativen Beitrags zum Brustkrebsrisiko im westlichen Lebensstil. Er verweist auf Studien an asiatischen Frauen, bei denen ein hoher Sojakonsum (eine Quelle für Phytoöstrogene) kein signifikant unterschiedliches Brustkrebsrisiko im Vergleich zu Frauen mit niedrigem Konsum zeigte.
Dr. Lippman vermutet, dass die potente Wirkung der körpereigenen Östrogene die Effekte dieser geringeren Umweltexpositionen überwiegt. Eine wichtige Ausnahme bilden Östrogene wie Diethylstilbestrol (DES), die DNA-Addukte bilden und als echte Karzinogene wirken können. Dies unterstreicht die komplexe Wirkungsweise verschiedener östrogener Substanzen.
Gestagene und Brustkrebsrisiko
Dr. Marc Lippman, MD, identifiziert Gestagene als Hauptverantwortliche für die Erhöhung des Brustkrebsrisikos. Historisch gesehen linderte die rein östrogenbasierte Therapie zwar menopausale Beschwerden, führte aber zu einem dramatischen Anstieg von Endometriumkarzinomen. Die Zugabe von Gestagenen sollte die Gebärmutterschleimhaut schützen – was auch gelang.
Im Gegensatz zur Gebärmutter stimulieren Gestagene jedoch das Brustgewebe. Dr. Lippman verweist auf Belege, die zeigen, dass die Zellteilungsraten in der Brust während der Lutealphase des Menstruationszyklus – wenn die Progesteronspiegel erhöht sind – am höchsten sind. Zudem erhöht eine Hormonersatztherapie mit Östrogenen plus Gestagenen die mammografische Brustdichte, einen Marker für Proliferation.
Ergebnisse der Women's Health Initiative
Dr. Marc Lippman, MD, erörtert die wegweisenden Women's Health Initiative (WHI)-Studien, die definitive Beweise für die Risiken der Hormontherapie lieferten. Die erste Studie randomisierte postmenopausale Frauen zu Placebo oder einer kombinierten Östrogen-plus-Gestagen-Therapie. Die Ergebnisse waren frappierend: Nach fünf Jahren Anwendung hatte sich die Brustkrebsinzidenz in der Hormontherapiegruppe verdoppelt.
Eine zweite WHI-Studie konzentrierte sich auf Frauen nach Hysterektomie. Diese erhielten randomisiert eine rein östrogenbasierte Therapie (Premarin) oder Placebo. Hier zeigte sich kein Anstieg des Brustkrebsrisikos durch reine Östrogene. Dieser kritische Unterschied bestätigte, dass die Gestagenkomponente der primäre Treiber des erhöhten Risikos in der ersten Studie war.
Empfehlungen zur Hormontherapie
Basierend auf den Evidenzen gibt Dr. Marc Lippman, MD, eine klare klinische Einschätzung ab: Gestagene seien "furchtbare Medikamente zur Brustkrebsförderung" und sollten den meisten Personen nicht verabreicht werden. Er betont, dass sie zudem der Gefäßgesundheit abträglich sind und das kardiovaskuläre Risiko erhöhen.
Das Gespräch mit Dr. Anton Titov, MD, unterstreicht die Bedeutung des Verständnisses von Krebsförderungsmechanismen. Für Frauen mit Brustkrebsrisiko, insbesondere bei familiärer Vorgeschichte oder genetischer Prädisposition, ist das Vermeiden einer kombinierten Östrogen-Gestagen-Therapie entscheidend. Die Ergebnisse erklären auch, warum Östrogenblocker wie Aromatasehemmer und Tamoxifen wirksam Rezidive verhindern, indem sie das fördernde Signal unterbinden.
Vollständiges Transkript
Dr. Marc Lippman, MD: Es gibt aber auch östrogenähnliche Substanzen und Umweltgefahren, über die gesprochen wird. Sogar in Thermopapier – etwa bei Bordkarten oder Quittungen – finden sich derartige Substanzen.
Dr. Anton Titov, MD: Wie beurteilen Sie Umweltgefahren, die Östrogenhormone nachahmen?
Dr. Marc Lippman, MD: Eine sehr wichtige Frage. Ich neige jedoch zu Skepsis. Umweltöstrogene existieren zweifellos – in Plastikflaschen und anderen Quellen. Excellente Forschung hat dies belegt. Die Frage ist vielmehr: In welchem Maße tragen sie zum Brustkrebsrisiko bei? Ein Ansatz ist, Bevölkerungsgruppen mit entsprechender Exposition zu betrachten. Sojaprodukte waren eine Hauptquelle solcher Östrogene.
Doch Studien an asiatischen Frauen – mit hohem oder niedrigem Sojakonsum – zeigen keine Unterschiede im Brustkrebsrisiko. Meiner Einschätzung nach werden diese vergleichsweise geringen Umweltöstrogene in einem westlichen Lebensstil von den körpereigenen Östrogenen überlagert. Ich halte ihren Einfluss für begrenzt.
Das könnte sich zwar noch ändern, aber momentan sehe ich die Frage als nicht abschließend geklärt. Um Ihre Frage umfassend zu beantworten, muss man verstehen, dass Östrogene grundsätzlich als Krebsförderer gelten.
Zur Erläuterung: In der Literatur wird zwischen Karzinogenen und Promotoren unterschieden. Ein Karzinogen verursacht Krebs, meist durch DNA-Schäden. Ein klassisches Beispiel sind Schornsteinfeger im England des 17. Jahrhunderts, die häufig Skrotumhautkrebs entwickelten – verursacht durch Teere, die sich am Körper ansammelten.
In Tierexperimenten bemalte man Mäuseohren mit Karzinogenen, was zu Hautkrebs führte. Bei immer geringeren Dosen blieb Krebs aus. Interessant wurde es, als man eine niedrige, nicht krebserregende Dosis eines Karzinogens mit mechanischer Reizung kombinierte: Dann entstand Krebs. Die Reizung wirkte also als Promotor.
Ähnlich fördern Östrogene genetische Veränderungen, die bereits vorliegen. Ein formaler Beweis: Frauen mit BRCA-Mutationen haben ein 90%iges Lebenszeitrisiko für Brustkrebs. Nach Kastration – was ich nicht empfehle – sinkt das Risiko jedoch minimal, da die östrogenbedingte Förderung entfällt.
Warum diese Ausführungen? Erstens, es ist faszinierend. Zweitens kehren wir damit zu den Umweltöstrogenen zurück. Einige davon sind nicht nur Promotoren, die Brustwachstum anregen, sondern bilden Östrogen-DNA-Addukte. Sie binden an den Östrogenrezeptor, gelangen in den Zellkern und können an transkriptionell aktiven Stellen DNA-Mutationen verursachen. Diethylstilbestrol (DES) war solch ein Karzinogen – es verursachte Krebs durch DNA-Addukte, nicht durch Förderung.
Dr. Anton Titov, MD: Und Progesteron?
Dr. Marc Lippman, MD: Eine faszinierende Geschichte. Sie zeigt einerseits Komplexität, andererseits Einfachheit. Sie erklärt, warum Östrogene Förderer sind – ähnlich wie eine niedrige Karzinogen-Dosis in Kombination mit Reizung Hautkrebs auslöst. Blockiert man die Östrogenwirkung mit Aromatasehemmern oder Tamoxifen, unterbindet man die Förderung – und damit die Krebsentstehung. Ein extrem wichtiger Punkt.
Historisch gab man Frauen in der Menopause Östrogene, um Beschwerden zu lindern. Premarin brachte Erleichterung – Hitzewallungen verschwanden, das Wohlbefinden stieg. Allerdings stieg auch die Rate an Endometriumkrebs, da Östrogene das Wachstum der Gebärmutterschleimhaut förderten. Also kombinierte man Östrogene mit Gestagenen, um die Gebärmutter zu schützen – was auch funktionierte.
Doch im Gegensatz zur Gebärmutter stimulieren Gestagene das Brustgewebe. Studien zeigen: Die Zellteilungsrate in der Brust ist während der Lutealphase – bei hohem Progesteron – am höchsten. Zudem erhöht eine Östrogen-plus-Gestagen-Therapie die mammografische Dichte, ein Proliferationsmarker. All dies war vorhersehbar.
Schließlich kam die Women's Health Initiative-Studie: 8000 postmenopausale Frauen erhielten Placebo oder Östrogen plus Gestagen. Das Ergebnis: Nach fünf Jahren hatte sich die Brustkrebsrate in der Hormongruppe verdoppelt. Östrogen plus Gestagen ist also katastrophal für das Brustkrebsrisiko.
Interessanterweise zeigte eine zweite WHI-Studie an Frauen nach Hysterektomie, die nur Östrogen (Premarin) oder Placebo erhielten, kein erhöhtes Brustkrebsrisiko. Der Risikofaktor sind also eindeutig die Gestagene. Diese sind nicht nur brutschädlich, sondern auch gefäß- und herzschädigend. Meiner Ansicht nach sollten sie weitgehend niemandem verabreicht werden.