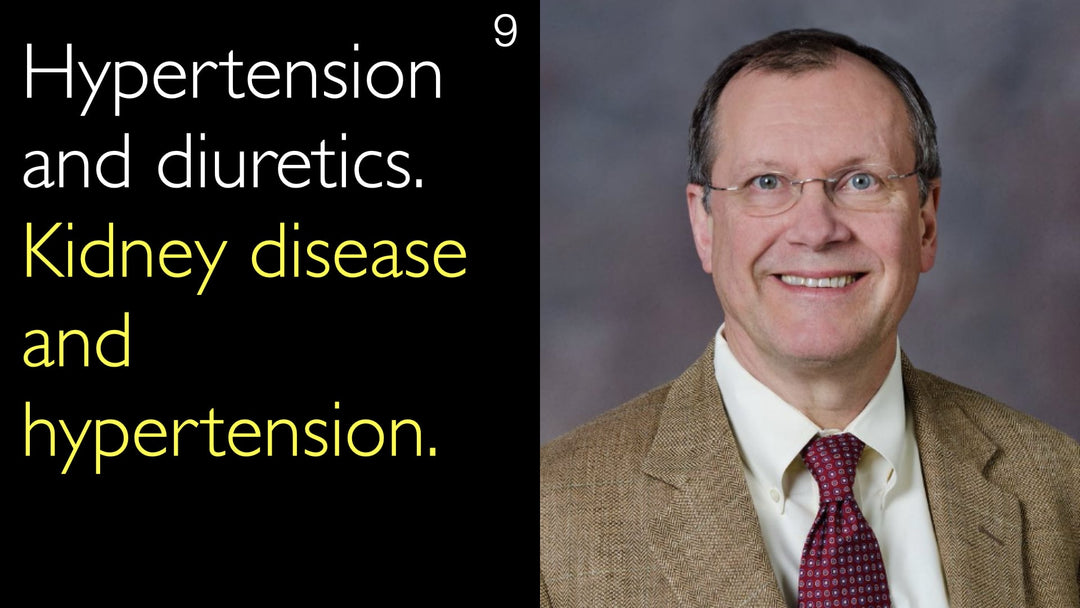Dr. Anton Titov, MD, erläutert entscheidende physiologische Veränderungen im Laufe der Zeit.
Wirkmechanismen der Diuretikatherapie bei Hypertonie und Nierenerkrankungen
Direktnavigation zu Abschnitten
- Wirkmechanismen von Diuretika bei Hypertonie
- Physiologische Veränderungen im Zeitverlauf
- Beurteilung des Volumenstatus
- Vorgehen bei chronischer Nierenerkrankung
- Unterschiedliche Therapieziele
- Vollständiges Transkript
Wirkmechanismen von Diuretika bei Hypertonie
Dr. David Ellison, MD, erläutert einen grundlegenden Lehrpunkt für Mediziner: Diuretika werden bei essenzieller Hypertonie primär nicht zur Reduktion des extrazellulären Flüssigkeitsvolumens eingesetzt. Er betont, dass dies ein verbreiteter Irrtum unter Klinikern sei. Zwar kommt es initial zu einer Salz- und Wasserausscheidung, was zu einer vorübergehenden Verminderung des Flüssigkeitsvolumens führt. Der langfristige blutdrucksenkende Effekt beruht jedoch auf einem anderen Mechanismus.
Physiologische Veränderungen im Zeitverlauf
Dr. Ellison beschreibt den faszinierenden zeitlichen Wandel der Diuretikawirkung. Der Blutdruck entspricht dem Herzzeitvolumen multipliziert mit dem systemischen Gefäßwiderstand. Anfangs führt die Diuretikagabe zu einem leichten Abfall des Herzzeitvolumens und einem Anstieg des systemischen Gefäßwiderstands – dennoch resultiert ein Nettoeffekt der Blutdrucksenkung. Innerhalb von etwa zwei Wochen normalisiert sich das Flüssigkeitsvolumen tendenziell, während der systemische Gefäßwiderstand signifikant sinkt. Nach einem Monat ist der Volumenstatus typischerweise normal, doch die Arteriolen sind erweitert.
Beurteilung des Volumenstatus
Im Interview mit Dr. Anton Titov, MD, werden wichtige Überwachungsparameter hervorgehoben. Dr. Ellison betont, dass die Volumenbeurteilung bei essenzieller Hypertonie nicht entscheidend sei, da Thiazide hier als wirksame Vasodilatatoren fungieren. Die Überwachung des Kaliumspiegels bleibt hingegen aufgrund bekannter Nebenwirkungen der Diuretika zentral. Dies erklärt, warum Gewichts- und Volumenkontrollen bei Hypertonikern weniger betont werden als bei Herzinsuffizienz-Patienten.
Vorgehen bei chronischer Nierenerkrankung
Dr. Ellison zieht eine entscheidende Unterscheidung für Patienten mit Nierenfunktionseinschränkung. Bei schwerer chronischer Nierenerkrankung, beispielsweise im Stadium vier, sei das Vorgehen "völlig anders". Hier stellt die Überladung mit extrazellulärer Flüssigkeit ein primäres Problem dar. Dr. Ellison empfiehlt eine sorgfältige körperliche Untersuchung zur Erfassung von Zeichen der Volumenüberladung, wie Ödeme, gestaute Halsvenen und Rasselgeräusche über der Lunge. Das Therapieziel verschiebt sich bei dieser Patientengruppe grundlegend.
Unterschiedliche Therapieziele
Dr. Ellison fasst die unterschiedlichen Therapieziele in Abhängigkeit von der Diagnose zusammen. Bei essenzieller Hypertonie senken Diuretika den Blutdruck primär durch systemische Vasodilatation – ein nur teilweise verstandener, wahrscheinlich multifaktorieller Mechanismus. Im Gegensatz dazu wirken sie bei chronischer Nierenerkrankung durch Reduktion des extrazellulären Flüssigkeitsvolumens. Beide Mechanismen senken den Blutdruck effektiv, jedoch über grundlegend verschiedene physiologische Ansätze.
Vollständiges Transkript
Dr. Anton Titov, MD: Bei Patienten mit Hypertonie, die chronisch Diuretika einnehmen – gibt es neben dem Blutdruckwert und vielleicht dem Kaliumspiegel noch andere Kriterien? Gibt es weitere Untersuchungen, die durchgeführt werden sollten?
Dr. David Ellison, MD: Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich lehre Medizinstudenten und Assistenzärzten typischerweise, dass wir Diuretika bei essenzieller Hypertonie meist nicht zur Reduktion des extrazellulären Flüssigkeitsvolumens einsetzen. Daher muss man nicht überlegen, ob der Patient Zeichen einer Überwässerung zeigt, denn das ist nicht der Grund für die Medikamentengabe.
Verabreicht man einem hypertensiven Patienten ein Thiazid-Diuretikum und misst Gewicht, Volumenstatus und systemischen Gefäßwiderstand, zeigt sich ein sehr interessantes, noch nicht vollständig verstandenes Phänomen. Zunächst scheidet der Patient mehr Salz und Wasser aus; das verringert sein extrazelluläres Flüssigkeitsvolumen.
Tatsächlich kann es sogar zu einem Anstieg des systemischen Gefäßwiderstands kommen. Zur Erinnerung: Blutdruck entspricht Herzzeitvolumen mal systemischem Gefäßwiderstand. Initial sinkt das Herzzeitvolumen leicht, und der systemische Gefäßwiderstand steigt leicht an, aber der Nettoeffekt ist eine Blutdrucksenkung.
Im Laufe von Tagen bis zwei Wochen ändert sich dies jedoch. Das Blutvolumen und das extrazelluläre Flüssigkeitsvolumen normalisieren sich tendenziell. Es normalisiert sich nie vollständig, aber es nimmt zu.
Während Blutvolumen, extrazelluläres Flüssigkeitsvolumen und Gewicht zunehmen, sinkt der systemische Gefäßwiderstand. Nach etwa einem Monat Thiazid-Therapie ist der Volumenstatus des Körpers typischerweise recht normal. Stattdessen sind die Arteriolen erweitert; der systemische Gefäßwiderstand ist reduziert.
Dr. Anton Titov, MD: Wie das Diuretikum den Abfall des systemischen Gefäßwiderstands verursacht, wird noch diskutiert.
Dr. David Ellison, MD: Ich finde es nach wie vor sehr verwirrend. Es ist wahrscheinlich multifaktoriell. Aber deshalb denken wir bei der Anwendung von Thiazid-Diuretika zur Behandlung der essenziellen Hypertonie nicht so sehr an das Volumen, weil wir sie eigentlich als Vasodilatatoren einsetzen, und sie sind sehr wirksam als Gefäßerweiterer. Daher spielt das Volumen bei Hypertonie keine große Rolle.
Wie bereits erwähnt, ist die Situation bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung, insbesondere schwerer chronischer Nierenerkrankung, völlig anders. Hier suchen wir zweifellos nach Zeichen einer Überladung mit extrazellulärer Flüssigkeit.
Hätte ich also einen Patienten in der Sprechstunde mit chronischer Nierenerkrankung im Stadium vier und einem Blutdruck von 190 zu 100, führe ich sicher eine gründliche körperliche Untersuchung durch und prüfe auf Volumenüberladung. Häufig benötigen diese Patienten eine tatsächliche Reduktion ihres extrazellulären Flüssigkeitsvolumens.
Der Einsatz des Diuretikums dient in dieser Situation also einem anderen Zweck. Letztendlich senkt es auch den Blutdruck, aber hier geschieht dies durch Verringerung des extrazellulären Flüssigkeitsvolumens. Bei essenzieller Hypertonie senkt es den Blutdruck dagegen durch systemische Vasodilatation.