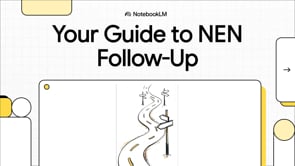Diese Übersichtsarbeit befasst sich mit pulmonalen neuroendokrinen Tumoren (PNET), einer Gruppe seltener Krebserkrankungen, die aus spezialisierten neuroendokrinen Zellen der Lunge hervorgehen. Anhand der Auswertung von 78 Studien werden diese komplexen Tumoren analysiert, deren Spektrum von langsam wachsenden typischen Karzinoiden bis hin zu hochaggressiven kleinzelligen Lungenkarzinomen reicht. Der Artikel präsentiert zentrale Erkenntnisse zu Diagnoseverfahren, molekularen Markern, Therapieoptionen und dem unterschiedlichen biologischen Verhalten der Tumoren in Abhängigkeit von ihren spezifischen Merkmalen. Besonders hervorgehoben wird die Bedeutung einer präzisen Klassifizierung für die Wahl der optimalen Behandlungsstrategie und die Einschätzung der Prognose.
Neuroendokrine Lungentumoren verstehen: Ein umfassender Patientenratgeber
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in neuroendokrine Lungentumoren
- Methodik der Studie
- Häufigkeit dieser Tumoren
- Typen und Grade neuroendokriner Lungentumoren
- Präkanzeröse Läsionen
- Symptome und klinische Merkmale
- Stadieneinteilung dieser Tumoren
- Molekulare und biologische Eigenschaften
- Diagnostische Verfahren
- Behandlungsoptionen
- Bedeutung für Patienten
- Studienlimitationen
- Empfehlungen für Patienten
- Quellenangaben
Einführung in neuroendokrine Lungentumoren
Neuroendokrine Lungentumoren (NELT) sind eine Gruppe seltener Krebserkrankungen, die aus spezialisierten Zellen hervorgehen, den sogenannten neuroendokrinen Zellen. Diese besonderen Zellen vereinen Eigenschaften von Nervenzellen und hormonproduzierenden Zellen und werden in der Lunge als Kulchitzky-Zellen oder argentaffine Zellen bezeichnet.
Erstmals beschrieben wurden diese Tumoren Anfang des 20. Jahrhunderts von Siegfried Oberndorfer, der beobachtete, dass sie tendenziell langsamer wachsen als typische Krebserkrankungen. Tatsächlich ist die Lunge der zweithäufigste Ort für neuroendokrine Tumoren im Körper – nach dem Magen-Darm-Trakt. NELT machen etwa 25 % aller neuroendokrinen Tumoren und etwa 1–2 % aller Lungenkrebsfälle aus, wobei manche Experten sogar von bis zu 20 % ausgehen.
Besonders herausfordernd ist ihre enorme Variabilität: Sie reichen von sehr langsam wachsenden, wenig aggressiven Tumoren bis hin zu extrem bösartigen Krebserkrankungen, die sich schnell ausbreiten. Diese Bandbreite macht eine präzise Diagnose und Klassifizierung unerlässlich, um die richtige Behandlung einzuleiten und den Krankheitsverlauf vorherzusagen.
Methodik der Studie
Dieser Artikel stützt sich auf eine systematische Auswertung der medizinischen Fachliteratur aus den Jahren 1981 bis 2020. Die Forscher durchsuchten medizinische Datenbanken mit spezifischen Schlüsselbegriffen zu neuroendokrinen Lungentumoren.
Zunächst identifizierten sie 103 potenziell relevante Studien. Nach strenger Prüfung – unter Ausschluss nicht-englischsprachiger Artikel und solcher ohne Volltext – blieben 78 hochwertige Studien übrig, die für diese Übersichtsarbeit gründlich analysiert wurden.
Das Forschungsteam setzte sich aus Spezialisten verschiedener Fachgebiete zusammen, darunter Thoraxchirurgie, Innere Medizin, Herzchirurgie, Anästhesiologie und Gynäkologie, um durch gebündelte Expertise ein umfassendes Bild dieser komplexen Tumoren zu zeichnen.
Häufigkeit dieser Tumoren
Neuroendokrine Lungentumoren gelten als seltene Krebserkrankungen. Die Häufigkeit variiert je nach Tumortyp:
- Pulmonale Karzinoide treten mit einer Rate von 0,2–2 Fällen pro 100.000 Personen in den USA und der EU auf
- Forschungsergebnisse deuten auf einen besorgniserregenden jährlichen Anstieg der NELT-Inzidenz um bis zu 6 % hin
- Eine US-Studie von 2004 bis 2014 verzeichnete einen jährlichen Zuwachs von 7 %
- Eine weitere US-Studie zeigte, dass die Inzidenz von 1,09 pro 100.000 im Jahr 1990 auf 5,25 pro 100.000 im Jahr 2004 stieg
Dieser Anstieg geht hauptsächlich auf mehr Karzinoidtumoren zurück, nicht auf aggressivere Typen. Neuroendokrine Tumoren machen insgesamt 75–80 % aller Lungenkrebserkrankungen aus, mit folgender Verteilung:
- 1–2 % sind Karzinoidtumoren
- 3 % sind großzellige neuroendokrine Karzinome (LCNEC)
- 15–20 % sind kleinzellige Lungenkarzinome (SCLC)
Pulmonale Karzinoide treten typischerweise zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr auf, mit einem Durchschnittsalter von 45 Jahren. Interessanterweise sind sie die häufigsten primären Lungentumoren bei Kindern und Jugendlichen. Im Gegensatz zu anderen Lungenkrebsarten ist Rauchen bei Karzinoidtumoren kein signifikanter Risikofaktor, steht aber in starkem Zusammenhang mit SCLC und LCNEC.
Typische Karzinoide sind etwa zehnmal häufiger als atypische, doch metastasieren atypische Karzinoide in 50 % der Fälle. Bei etwa 28 % der NELT-Patienten liegen bei der Diagnose bereits synchrone Metastasen vor (gleichzeitiges Auftreten von Primärtumor und Streuherden).
Typen und Grade neuroendokriner Lungentumoren
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ein Klassifikationssystem etabliert, das neuroendokrine Lungentumoren anhand mikroskopischer Merkmale in vier Hauptkategorien einteilt:
Typisches Karzinoid (TC): Tumoren mit Karzinoid-Erscheinungsbild, weniger als 2 Zellteilungen (Mitosen) pro 2 mm² (entsprechend 10 hochauflösenden Mikroskopfeldern), ohne Nekrose (abgestorbenes Gewebe) und einer Größe von mindestens 0,5 cm.
Atypisches Karzinoid (AC): Karzinoid-Morphologie mit 2–10 Mitosen pro 2 mm² oder Nachweis von Nekrose (meist fleckförmig).
Großzelliges neuroendokrines Karzinom (LCNEC): Zeigt neuroendokrine Muster (organoide Cluster, Palisaden, trabekuläre Zellen) mit hoher Mitoserate von über 11 pro 2 mm² (Median 70), oft mit ausgedehnten Nekrosen. Die Zellen sind groß mit niedrigem Kern-Zytoplasma-Verhältnis.
Kleinzelliges Lungenkarzinom (SCLC): Besteht aus kleinen Zellen mit spärlichem Zytoplasma, feingranulärer Chromatinstruktur, fehlenden Nukleolen und sehr hoher Mitoserate (Median 80 pro 2 mm²) mit großen Nekrosezonen.
2018 führten WHO und Internationale Agentur für Krebsforschung ein Grading-System ein:
- G1: Gut differenziertes neuroendokrines Karzinom (typisches Karzinoid)
- G2: Mäßig differenziertes neuroendokrines Karzinom (atypisches Karzinoid)
- G3: Schlecht differenziertes neuroendokrines Karzinom (umfasst LCNEC und SCLC)
Einige Forscher schlagen vor, hochgradige neuroendokrine Tumoren molekular weiter zu unterteilen in: aggressive primäre hochgradige NET (70–75 % der SCLC), sekundäre hochgradige NET (20–25 % der NELT) und indolente NET (5 % der NELT, einschließlich einiger Karzinoide bei Frauen und jungen Patienten).
Präkanzeröse Läsionen
Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass sich manche NELT aus Vorstufen, sogenannten Präkanzerosen, entwickeln. Die bekannteste ist die neuroendokrine Zellhyperplasie der Lunge, die häufig bei Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen wie Bronchiektasen, obliterierender Bronchiolitis und interstitieller Lungenerkrankung vorkommt.
In etwa 25 % der Karzinoidtumor-Fälle findet sich eine neuroendokrine Hyperplasie im umgebenden Lungengewebe. Bildet diese Zellvermehrung Knoten unter 0,5 cm, spricht man von "Tumorlets". Diese zeigen mikroskopisch keine Mitosen oder Nekrosen und weisen einen niedrigen Ki67-Index (Zellteilungsmarker) auf.
Ein anderer Zustand, die diffuse idiopathische neuroendokrine Zellhyperplasie (DIPNECH), umfasst Fibrose und kleine knotige Aggregate neuroendokriner Zellen. Er tritt häufiger bei Frauen und Patienten mit obliterierender Bronchiolitis auf. Etwa 5 % der typischen und atypischen Karzinoidfälle sind mit multipler endokriner Neoplasie Typ 1 (MEN-1), einem genetischen Syndrom, assoziiert.
Einige Tumoren zeigen "multidirektionale Differenzierung", das heißt, sie enthalten verschiedene Zelltypen wie schleimproduzierende oder Plattenepithelzellen neben neuroendokrinen Komponenten, was die manchmal auftretenden Mischformen erklärt.
Symptome und klinische Merkmale
Die Symptome bei NELT hängen von Lage, Typ, Größe und Aggressivität des Tumors ab. Die häufigsten klinischen Manifestationen von Karzinoidtumoren sind:
- Husten
- Kurzatmigkeit (Dyspnoe)
- Wiederkehrende Atemwegsinfektionen
- Bluthusten (Hämoptoe)
Periphere NELT (weiter außen in der Lunge) sind oft symptomlos und werden zufällig bei Bildgebungen entdeckt. Nach ihrer Hormonaktivität lassen sich diese Tumoren einteilen in:
Funktionelle (sekretorische) Tumoren: Produzieren Hormone oder Vorläufer. Über 90 % der NELT sind nicht-funktionell, aber bei Hormonsekretion können spezifische Syndrome auftreten:
- Adrenocorticotropes Hormon (ACTH)-Sekretion, die zum Cushing-Syndrom führt
- Antidiuretisches Hormon (ADH)-Sekretion, die ein Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion (SIADH) verursacht
- Serotonin-Sekretion, die zum Karzinoidsyndrom führt
Nicht-funktionelle Tumoren: Produzieren keine signifikanten Hormone.
Einige paraneoplastische Syndrome (durch Krebs verursacht, aber nicht durch direkte Tumoreinvasio
Weitere vielversprechende Marker umfassen CXCL-12-Zytokine für atypische Karzinoide, Stathmin-1 für hochgradige Tumore, Nestin zur Unterscheidung von LCNEC und Karzinoiden sowie DLL3-Genexpression bei LCNEC und SCLC.
Bluttests mit niedrigen 5-HIAA-Spiegeln (Serotoninabbauprodukt) bei hohem Chromogranin A können auf schlechtere Prognosen hindeuten. Entzündungsmarker wie das Neutrophilen-Lymphozyten-Verhältnis (NLR) und Laktatdehydrogenase (LDH) liefern ebenfalls prognostische Informationen.
Diagnostische Verfahren
Die Diagnose von Lungenneuroendokrinen Tumoren (LNET) erfordert einen vielschichtigen Ansatz. Über 40 % der Fälle werden zufällig bei Routine-Röntgenaufnahmen entdeckt. Die bildgebende Referenzmethode ist die kontrastmittelgestützte Computertomographie (CT) des Thorax.
Zum Nachweis gut differenzierter NET hat sich die Einzelphotonen-Emissionscomputertomographie mit dem 99mTc-Tektrotyd-Tracer, der Somatostatinrezeptoren anzielt, als hochwirksam erwiesen. Für niedriggradige NET zeigt die 68Ga-DOTANOC-Positronenemissionstomographie (PET-CT) eine überlegene Sensitivität.
Die 18-Fluorodesoxyglukose-PET-CT eignet sich besonders für niedrig- und mittelgradige NET, mit einer Sensitivität, die anderen PET-Techniken entspricht. Die Somatostatinrezeptor-PET ist wertvoll zur Identifizierung von Metastasen.
Die Bronchoskopie ist äußerst nützlich zur Diagnose aller NET-Formen, besonders bei bronchialer Beteiligung. Es ist ein sicheres Verfahren und die häufigste Methode zur Gewebeprobenentnahme für die definitive Diagnose.
Der Diagnoseprozess umfasst typischerweise:
- Bildgebung zur Tumorbokalisation
- Biopsie zur Gewebeprobenentnahme
- Mikroskopische Untersuchung durch einen Pathologen
- Immunhistochemische Färbung zur Markeridentifizierung
- Gegebenenfalls genetische Tests für Therapieentscheidungen
Behandlungsoptionen
Das primäre Ziel bei lokalisierten LNET ist die vollständige chirurgische Entfernung, wann immer möglich. Der chirurgische Ansatz hängt von Tumorgröße, -lage und -typ ab.
Für fortgeschrittene, nicht operabel entfernbaren LNET umfassen die Optionen:
- Somatostatinanaloga zur Kontrolle hormonbedingter Symptome
- Everolimus bei fortschreitenden Tumoren
- Peptidrezeptor-Radionuklidtherapie (PRRT) für Tumore mit Somatostatinrezeptorexpression
- Chemotherapieregime ähnlich denen beim kleinzelligen Lungenkarzinom
- Immuntherapie für Tumore mit PD-L1-Expression
Die Therapieplanung erfordert ein multidisziplinäres Team aus Thoraxchirurgen, medizinischen Onkologen, Radioonkologen, Pneumologen und Pathologen, um individuelle Strategien basierend auf Tumoreigenschaften und Patientengesundheit zu erstellen.
Bedeutung für Patienten
Diese Übersicht hebt mehrere wichtige Punkte für Patienten mit LNET-Diagnose hervor:
Erstens ist es entscheidend zu verstehen, dass LNET eine heterogene Gruppe mit sehr unterschiedlichem Verhalten und Prognosen darstellt. Eine genaue Diagnose von Typ und Grad ist unerlässlich für die richtige Behandlung.
Zweitens bedeutet die zunehmende Inzidenz, dass mehr Forschungsaufmerksamkeit auf Verständnis und bessere Behandlungen gerichtet wird. Die molekulare Charakterisierung führt zu zielgerichteteren Therapien, die Prognosen verbessern und Nebenwirkungen reduzieren können.
Drittens erfordert die komplexe Natur eine Behandlung in Zentren mit Erfahrung in neuroendokrinen Tumoren. Der multidisziplinäre Ansatz stellt sicher, dass alle Aspekte der Erkrankung umfassend angegangen werden.
Schließlich sollten Patienten wissen, dass sich Behandlungsstrategien kontinuierlich weiterentwickeln. Die Teilnahme an klinischen Studien kann Zugang zu modernsten Behandlungen bieten und zum medizinischen Wissen beitragen.
Studienlimitationen
Obwohl diese Übersicht wertvolle Einblicke bietet, ist es wichtig, ihre Grenzen zu erkennen. Als Literaturübersicht unterliegt sie einem Publikationsbias – der Tendenz, dass Studien mit positiven Ergebnissen häufiger veröffentlicht werden.
Die eingeschlossenen Studien erstrecken sich über vier Jahrzehnte, in denen sich Diagnosekriterien, Klassifikationen und Behandlungen erheblich weiterentwickelt haben. Diese Heterogenität erschwert direkte Vergleiche.
Zusätzlich bedeutet die Seltenheit, dass most Studien relativ kleine Patientenzahlen umfassen, was die statistische Aussagekraft limitiert. Viele Studien waren retrospektiv (Betrachtung vorhandener Daten) statt prospektiv, was potenzielle Verzerrungen einführt.
Schließlich bedeuten die raschen Fortschritte in molekularen Tests und zielgerichteten Therapien, dass manche Informationen, besonders zu Behandlungen, schnell veralten können.
Empfehlungen für Patienten
Basierend auf dieser Übersicht sind hier wichtige Empfehlungen:
- Spezialisierte Versorgung suchen: Aufgrund der Komplexität und Seltenheit von LNET wird eine Behandlung in Zentren mit Expertise für neuroendokrine Tumore empfohlen.
- Umfassende Testung sicherstellen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Diagnostik angemessene immunhistochemische Färbungen und gegebenenfalls molekulare Tests umfasst.
- Alle Behandlungsoptionen besprechen: Besprechen Sie basierend auf Ihrem Tumortyp und -stadium chirurgische Optionen, Medikamente und neuere Behandlungen wie zielgerichtete Therapien und Immuntherapie.
- Genetische Beratung in Betracht ziehen: Da etwa 5 % der Karzinoidfälle mit MEN-1 assoziiert sind, kann genetische Beratung sinnvoll sein, besonders bei familiärer Vorgeschichte endokriner Störungen.
- Nach klinischen Studien fragen: Erkundigen Sie sich nach verfügbaren klinischen Studien für Zugang zu neuen Behandlungen.
- Unterstützung suchen: Nehmen Sie Kontakt mit Patientenorganisationen für neuroendokrine Tumore auf für zusätzliche Ressourcen und Gemeinschaft.
- Nachsorge beibehalten: Diese Tumore erfordern langfristige Überwachung auch nach erfolgreicher Erstbehandlung, da manche Jahre später zurückkehren können.
Quellenangaben
Originalartikeltitel: Lungenneuroendokrine Tumore: Eine systematische Literaturübersicht (Review)
Autoren: Cornel Savu, Alexandru Melinte, Camelia Diaconu, Ovidiu Stiru, Florentina Gherghiceanu, Ștefan Dragoș Octavian Tudorica, Oana Clementina Dumitrașcu, Angelica Bratu, Irena Balescu, Nicolae Bacalbasa
Veröffentlichung: Experimental and Therapeutic Medicine 23: 176, 2022
Eingegangen: 25. Juni 2021; Angenommen: 27. Juli 2021
DOI: 10.3892/etm.2021.11099
Dieser patientenfreundliche Artikel basiert auf begutachteter Forschung und soll helfen, komplexe medizinische Informationen zu verstehen. Konsultieren Sie immer Ihr Behandlungsteam für auf Ihre Situation zugeschnittene Ratschläge.